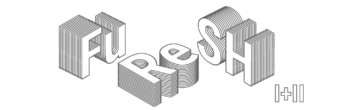Ein Booksprint, viele Perspektiven, ein gemeinsames Ergebnis
Vor mehr als einem Jahr entstand in der Kompetenzwerkstatt Digital Humanities die Idee, Kolleg*innen aus dem Bereich Digital Humanities zusammenzubringen. Insbesondere jene, die an Bibliotheken, in Labs, Makerspaces oder Kompetenzzentren arbeiten. Ziel war es, in einem Booksprint gemeinsam über Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungsansätze zu reflektieren.
Nach vielen Monaten der Planung, intensiver Zusammenarbeit, zahlreicher Ideenrunden und mit viel Engagement ist das Ergebnis nun veröffentlicht: Die aktuelle Ausgabe von ABI Technik widmet sich unter dem Titel „Making Research. Digital Humanities Fachreferate, Labs, Makerspaces, Werkstätten und Kompetenzzentren an wissenschaftlichen Bibliotheken und anderen Forschungseinrichtungen“
dem vielfältigen und sich dynamisch entwickelnden Feld der Digital Humanities in institutionellen Kontexten.
Fast 30 Autor*innen aus verschiedenen Einrichtungen haben ihre Perspektiven, Erfahrungen und Konzepte eingebracht. Die Beiträge spiegeln ein breites Spektrum wider: von konkreten Räumen über digitale Methoden und Infrastrukturen bis hin zu übergeordneten Fragen wissenschaftlicher Praxis und Vernetzung.
Ein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten, die mit ihren Texten, Ideen und ihrer Zeit dieses Schwerpunktheft möglich gemacht haben. Ebenfalls danken wir den Herausgeber*innen von ABI Technik für die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit.
Zur Ausgabe geht es hier: https://www.degruyterbrill.com/journal/key/abitech/45/3/html
Eine Zusammenfassung von Ben Kaden (@bkaden)
Der Abschlussworkshop des FuReSH-Projektes zeigte, dass er eigentlich keiner sein sollte. Denn die Idee einer niedrigschwelligen Vermittlungsinstanz für die Angebote, Möglichkeiten und notwendig auch Grenzen digitaler Forschung in den Geisteswissenschaften ist auf der Höhe der Zeit. Zumindest sahen es die Teilnehmenden so. Interessant ist dabei, dass sich die Sicht auf die Funktionen der Scholarly Makerspaces während der Diskussionen noch einmal stärker erweiterte. Im Idealfall sollten sie nämlich, wie deutlich wurde, erheblich mehr sein, als ein reines Unterstützungsangebot, mit dem die Universitätsbibliothek Lehrenden, Forschenden und Studierenden den aktuellen Stand im Bereich digitaler Werkzeuge für die Kultur- und Geisteswissenschaften näher bringt.
Mittlerweile ist offensichtlich, wie sehr sich mit der digitalen Forschung und den Digital Humanities und weiteren Transformationsphänomenen wie u.a. der offenen Wissenschaft grundsätzlich etwas verschiebt, das lange stabil abgegrenzt schien. Das Funktionssystem Wissenschaft und seine Schnittpunkte zu weiteren gesellschaftlichen Bereichen werden unter diesen Vorzeichen neu, und zwar stetig neu, definiert. Bestimmte Elemente – Faktenorientierung, Systematizität, Verfahrenstransparenz – und Prinzipien bleiben stabil. Aber oft scheint es, als rückten gerade die diskursiv- und deutungsorientierten Communities zunehmend in die Rolle einer Qualitätssicherung des Wissens, dessen Produktion an anderen Stellen erfolgt. In jedem Fall finden eine Vielzahl von ebenfalls verständnis- und erkenntnisgerichteten Prozessen und insbesondere solche der Problemlösung an anderen Stellen als der akademisierten Wissenschaft statt. Wissenschaftliche Expertise wird im Zweifel hinzugezogen, wissenschaftliche Strenge je nach Bedarf angewandt. Aber das Ziel solcher Wissensprozesse ist nicht mehr auf einen generellen Wissenszuwachs an sich gerichtet. Wissenschaft als Institution und Praxis arbeitet zunehmend projektbasiert und damit auf sehr konkrete und bestimmbare Ergebnisse hin. Allgemeinere Einsichten sind eine Art Nebenprodukt, das die Best-Practice-Erfahrungen begleitet. In welcher Form dies dokumentiert wird, ist eine Aufgabe für das wissenschaftliche Publikationswesen. Projektblogs wie dieses sind ein Weg. Zugleich wäre aber ein differenziertes Wissensmanagement notwendig, da ein Großteil solcher Expertise nur teilweise kontinuierlich in den Laufzeitzyklen der Projekte, also in Rahmen von zwei bis drei Jahren entsteht. Danach, auch darüber wurde im Workshop gesprochen, beginnt für die Akteure ein im Idealfall inhaltlich ähnliches, im konkreten Bezug aber oft doch anderes Kapitel. Wo also ließe sich so ein Wissen strukturiert und nachnutzbar abgebildet akkumulieren? Für den Bereich der digital geprägten Geisteswissenschaften könnte einer dieser Ort der sein, der bereits traditionell publiziertes Wissen sammelt – also die Bibliothek. Entsprechend notwendig ist es für die Scholarly Makerspaces, ein System für die Sammlung, Strukturierung und Bereitstellung entsprechender Expertise vorzuhalten. Für die Implementierung ist dieser Aspekt daher ausdrücklich mit beantragt. Und überhaupt bewegt man sich mit einem DFG-Projekt aus dem LIS-Bereich in einem für diese Entwicklung im Prinzip genau richtigen Wirkungszusammenhang. Wir wissen schon aus eigener Erfahrung sehr gut, welche besonderen Anforderungen sich in vorwiegend über Drittmittel finanzierten Forschungszusammenhängen ergeben. An engen Zeiträume und konkreten Umsetzungszielen ausgerichtete Forschung ist unabweislich auch Teil des Kulturwandels. Es bietet sich an, dies im Zusammenhang zu sehen und im Gegenzug entsprechende zeitgemäße und nachhaltige Infastrukturangebote aufzusetzen. Für ihren Wirkungsradius gehören die Scholarly Makerspaces in diesen Funktionsrahmen für die Wissenschaft, vielleicht auch besser Wissensarbeit der Gegenwart.
Rolle und Abgrenzung der Scholarly Makerspaces
Die Grundidee der Scholarly Makerspaces, nämlich die Vermittlung von Kompetenzen, Entwicklungen, möglicherweise Ressourcen und in jedem Fall Vernetzungen für die digitale Forschung in den Kultur- und Geisteswissenschaften enthält grundständig die Möglichkeit, die Begleitung und Moderation eines solchen Kulturwandels institutionell einzubetten. Scholarly Makerspaces sind im besten Umsetzungsfall eine niedrigschwellig nutzbare und agile Lösung für eine konzentrierte und aufgeklärte Auseinandersetzung mit den jeweils relevanten Fragestellungen. Mit ihrem Dienst der Forschungs- und Antragsberatung helfen sie bei den jeweiligen und oft zeitkritischen Entscheidungsfindungen. Als Begegnungsraum führen sie unterschiedliche Akteure, die in dieser Transformation aber unbedingt im Dialog stehen sollten, zusammen. Im besten Fall entstehen dadurch neue Ideen, Konzepte, Forschungsfragen und Umsetzungspläne. Für alle Beteiligten bis hin zur anbietenden Institution eröffnen sie die Möglichkeit, die entsprechenden Entwicklungen kennenzulernen, zu verstehen, zu bewerten und insgesamt selbst zu partizipieren. Dazu zählt ebenfalls, Vorstellungen von der eigenen Rolle regelmäßig konstruktiv zu hinterfragen, etwas, das gerade auch für wissenschaftliche Bibliotheken unerlässlich ist.
Scholarly Makerspaces sind daher zwar an einigen Stellen ähnlich, aber keinesfalls identisch mit funktionsorientierten (Library) Labs. Die Bereitstellung von Werkzeugen, Workflows, Methoden, Materialien und einer ganze Palette von kleinen praxistauglichen Lösungen, die man im Workshop als Hacks bezeichnet und die im Sinne des Wissensmanagements auch formalisiertes Erfahrungswissen genannt werden könnten, bildet nur eine Facette der Scholarly Makerspaces. Die begleitete, in der Komplexität überschaubare und auf individuelle Anforderungen und Kompetenzen Rücksicht nehmende Vermittlung markiert eine zweite Facette. Die dritte ist schließlich die, wofür man Scholarly Makerspaces trotz aller Digitalität unbedingt als Raum benötigt: Die eines Ortes für den Kontakt und wechselseitigen Austausch von unterschiedlichen Akteuren. Die Scholarly Makerspaces sollen in Addition der Angebotsfacetten ihren unmittelbaren Zielgruppen ermöglichen, die Anbindung zu aktuellen Entwicklungen, Möglichkeiten und Diskussionen zu halten, vielleicht auch mitzugestalten. Dadurch jedoch, dass dies nur über die Integration Akteure gelingt, die die jeweiligen Entwicklungen, Möglichkeiten und Diskussionen selbst prägen, verschiebt sich möglicherweise in der Zeit auch das, was die Zielgruppe darstellt. Für den Anfang sollen in den Scholarly Makerspaces lokale Akteure jeweils bedarfsgerecht mit den für ihre Ansprüche relevanten Werkzeugen, Verfahren, Informationen und Kontakten zusammengeführt werden.
Der Einstieg über und eine Verankerung von konkreten (technischen) Lösungen – z.B. über Workstations mit vorinstallierten Ready-to-Use-Werkzeugen – und begleitenden Schulungen zum Kompetenzerwerb für die lokalen Communities ist sicher zielführend, auch um Akzeptanz für das Angebot zu schaffen. Zugleich empfiehlt sich jedoch, die Rolle der Scholarly Makerspaces als Organisations- und Vermittlungsort für die digitale Transformation und den Kulturwandel in der Wissenschaft von Beginn an offensiver zu denken. Vermittlung heißt in diesem Fall auch aktive Moderation, Kanalisieren, zielgruppengerechtes Aufbereiten, bei Bedarf geduldiges Erklären und vor allem ein Im-Blick-Behalten und Verstehen, also Monitoring, dessen was generell in den einschlägigen Bereichen geschieht.
Eine umfassende technische Grundversorgung für die Breite möglicher Anforderungen scheint aus diversen Gründen unmöglich. In den Gesprächen zur Konzeptentwicklung wurden wir aus guten Gründen regelmäßig vor einem solchen Anspruch gewarnt. Er wäre im Prinzip für die Scholarly Makerspaces auch wenig sinnvoll. Denn wo es Lösungen gibt, gibt es bereits Expertise und wenn sie bei den Entwickler*innen liegt. Es kristallierte sich auch während des Workshops heraus, dass die zentrale Rolle der Betreibenden eines Scholarly Makerspaces neben einer Grundberatung die des Community-Managements sein muss. Genaugenommen handelt es sich um Communities, also den Plural, die je nach Anforderung, Bedarf oder Szenario zueinandergeführt und so moderiert werden müssen, dass sie sich verstehen und konstruktiv kommunizieren können. Das Angebot konkreter Werkzeuge sollte sich auf besonders attraktive, grundständige und reife Lösungen konzentrieren. Für alle Materialien liegt der Schwerpunkt nicht im Sammeln auf Vollständigkeit, sondern in einer an konkreten Kriterien ausgerichteten Kuratierung. Die beiden Schwerpunkte für den Betrieb der Scholarly Makerspaces sind also diese Kuratierung und die Anregung, Koordination, Pflege und Unterstützung von entsprechenden Nutzungscommunities, also konkreter Programmarbeit, beginnend bei Schulungen und bis hin zu Symposien und Hackathons. Wie komplex sich diese Aufgaben darstellen, ist nicht pauschal bestimmbar. Bei relativ homogenen Gruppen reicht es vielleicht, den Raum als eine Art Bühne bereitzustellen. In anderen Fällen bedarf es einer ausgeprägten Moderation und gegebenenfalls auch Übersetzungsleistung.
Scholarly Makerspaces als Bühne – das Beispiel Hackathons und Coding-X
Während es bislang noch keine Scholarly Makerspaces im Sinn des FuReSH-Projektes gibt, gibt es doch durchaus eine Reihe von Erfahrungen mit der Aktivierung und Lenkung von community-basierter Aktivierung und Auseinandersetzung mit Forschungsmaterialien und digitalen Lösungen. Ein großer Appeal und sehr gute Erfahrungen werden so genannten Hackathons bzw. “Coding X”-Veranstaltungen zugeschrieben. Die Rolle der Betreibenden des Makerspaces läge in diesem Zusammenhang vorwiegend auf der Kuration und Organisation solcher Veranstaltungen. Zugleich wären sie Ansprechpartner für ein akutes Desiderat: Wo und in welcher Form werden die Ergebnisse solcher Veranstaltungen dauerhaft verfügbar gehalten. Wie auch in anderen Fällen – zum Beispiel beim technischen Support – erweist sich die Einbettung der Scholarly Makerspaces in das institutionelle Gefüge der Hochschule als Vorteil. Nach Möglichkeit sollten an diesem Punkt bestehende Angebote wie Repositorien aktiv eingebunden werden.
Nach dem Konzept der “Scholarly Makerspaces als Bühne” würden zudem unterschiedliche Akteure den Ort in regelmäßigem Wechsel bespielen können. Dies ist bis hin zu einer weitgehend eigenverantwortlichen Ausgestaltung und Nutzung denkbar. Die Aktivitäten konzentrierten sich auch hier weniger auf die technische Expertise als auf die Vernetzung. Ein Vorteil des Ansatzes wäre, dass die Aktualisierung gewissermaßen Community-getrieben erfolgte und sich die Betreibenden stärker auf die Dokumentation bzw. das Wissensmanagement konzentrieren könnten. Dies setzt jedoch zunächst entsprechend motivierte Communities voraus. Die Betreibenden müssen im Gegenzug aufgeschlossen und anschlusswillig, möglicherweise sogar aktiver Teil einer solchen Community sein.
Anwendungsfälle
Das SBB-Lab, vorgestellt durch Clemens Neudecker, ist ein gutes Beispiel für den Ansatz, digitalisierte Ressourcen für eine ergebnisoffene Nachnutzung verfügbar zu machen. Dabei ist diese Offenheit auch 2019 oft noch eine Herausforderung und muss – auch im eigenen Haus – als Idee vermittelt werden. Das Lab stellt aktuell Datensätze bereit, die als Testdaten auch für Scholarly Makerspaces genutzt werden könnten. Zugleich ist es mit seinem Auftritt und der Datenpräsentation ein Anwendungsfall für die Datenvermittlung, der entsprechend als Orientierung für den Aufbau von Scholarly Makerspaces betrachtet werden könnte. Zu beachten wären jedoch die Besonderheiten der Trägereinrichtung, also der Staatsbibliothek zu Berlin.
Beim Austausch zu den Erfahrungen mit Hackathons wie Coding Gender wurde zudem eine weitere mögliche Angebotsfacette für Scholarly Makerspaces sichtbar. Neben den Werkzeugen (und der Hardware), den Beständen und Verfahren stellen auch Ablaufdokumentationen für die Entwicklung von Nutzungslösungen einen wichtigen Vermittlungsaspekt dar, wie Michael Müller von der Mosse Art Research Initiative (MARI) betonte. Eine Sammlung von nachvollziehbar dokumentierten “Hacks” zur Annäherung an Kulturdaten bleibt bisher ein Desiderat, das vergleichsweise leicht bei entsprechenden Sessions bedient und aufgefangen werden könnte. Die Aufbereitung, Ergänzung und Weiterentwicklung solcher Erfahrungsdokumentationen könnte in einer Wikistruktur über die Community erfolgen und in das Wissensmanagementsystem der Scholarly Makerspaces intergriert werden. Die Aufgabe des Labs bzw. der Scholarly Makerspaces wäre demnach auch hier die Bereitstellung und Sicherung der Infrastruktur, die Moderation und die kuratierende Gestaltung. Auf diesem Weg ließen sich nebenbei auch die Use Cases sichtbar machen, die für eine erfolgreiche Ausgestaltung und Vermittlung des digitalen Kulturwandels so notwendig sind.
Anna Busch vom Theodor-Fontane-Archiv Potsdam und dem dortigen TFA.Lab berichtete ebenfalls von sehr guten Erfahrungen mit Hackathons. Die von ihr beschriebenen Erfahrungen demonstrierten besonders anschaulich, wie digitale Werkzeuge vor allem ein Mittel zum Zweck darstellen und es neben der Bereitstellung der Tools auch darauf ankommt, digitale Forschung auch als eine besondere Form der Auseinandersetzungspraxis mit Kultur zu sehen. Mit der Betonung des Prinzips der Agilität und der sehr breiten Vernetzung dekonstruiert digitale Wissenschaft in gewisser Weise auch klassische disziplinäre Abgrenzungen. Das Archiv stellt den Gegenstandsbereich, der aus diversen, auch unerwarteten, nicht zwingend primär literaturwissenschaftlichen Blickwinkeln adressiert, beforscht und genutzt wird. Im Zweifel orientiert man sich an einem für Veranstaltung gesetzten Oberthema oder einem verbindenden Motto (wie bei Coding Gender). Eine deckungsgleiche Anpassbarkeit an die traditionelle Binnenstrukturierung von Wissenschaftsdomänen wird dagegen nicht angestrebt, ist in vielen Fällen sogar gerade nicht gewünscht.
Im Fall des Fontane-Archivs wurden die Textkorpora zum Werk Theodor Fontane also nur als Beispielmaterial zu Erprobung unterschiedlicher Auseinandersetzungsformen mit solchen Daten benutzt. Im Ergebnis standen weniger neue Erkenntnisse zur Fontane-Forschung als zu digitalen Verfahren, die auch für die Fontane-Forschung bedeutsam sein können. Die Idee von Hackathons ist die aktive und offene Erprobung des Möglichen, zu der auch das Scheitern und Lernen aus diesem Scheitern gehören. Kurioserweise hält über solche Umwege eine Freiheit der Auseinandersetzung mit Forschungsmaterialien wieder Einzug, die in den eng gesetzten Arbeitsplänen drittmittelfinanzierter Projektforschung nur noch sehr begrenzt Raum findet.
Das hat auch wiederum Folgen für die Wissenschaft und ihr Selbstverständnis. Für einen Hackathon wie den des TFA.Lab sind die Korpora stärker exemplarisch als strukturierte Datafizierungen literarischer Werke als dass sie als Bezugsgegenstand einer unmittelbaren Fontane-Forschung mit konkreten Erkenntniszielen verarbeitet werden. Dies leitet auf eine Grundbedingung datenbasierter geistes- und kulturwissenschaftlicher Forschung über: es gibt eine Fluidität zwischen zwei Ebenen. Auf der einen Seite steht eine Datenstruktur, die idealerweise standardisiert und als Linked-Open-Data offene Kontextualisierungen eröffnet und Verfahren wie eine Distant Reading ermöglicht. Auf der anderen die, wenn man so will, ästhetische zu rezipierende Ausprägung, die für die Nahlektüre, hermeneutische Auslegungen und natürlich auch den sinnlichen Werkgenuss essentiell ist. Abstrakt gesehen bedeutet digitale Wissenschaft eine genuin doppelte Sicht auf Forschungsobjekte. Wenigstens für die aktuelle Transformationsphase kollidiert diese Konsequenz oft mit traditionelleren Vorstellungen. Sie entspricht aber der spezifischen Medialität und dem Potential des Digitalen, also Datafizierung, Verknüpfung, Re-Visualisierung u.ä. Die Scholarly Makerspaces können und sollen durchaus ein Ort sein, um diese Spannung zwischen verschiedenen Formen der Auseinandersetzung mit Kulturobjekten und damit einhergehenden Deutungsansprüchen konstruktiv und verständnisorientiert zu verhandeln.
Neue Partner
Maxim Kupreyew von der BBAW ergänzte eine weitere, in klassischeren akademischen Kulturen vermutlich eher noch unerwartetere Kooperation. Für die Entwicklung des Computerspiels Assassin’s Creed Origins kooperierte die Produktionsfirma Ubisoft Entertainment SA mit Ägyptolog*innen im Rahmen einer so genannten Hieroglyphen-Initiative. Die Firma hatte die Ressourcen, um breit aufgestellt mit maschinellem Lernen eine Übersetzungswerkzeug für Hieroglyphen zu entwickeln. Die technischen und inhaltliche Ergebnisse werden, so die Ankündigung, Open Source zur Verfügung gestellt. Kulturelle Ergebnisse dieser Kooperation sind neben einem authentischeren Spieleerlebnisse auf der Höhe der Ägyptologie auch eine Popularisierung des Thema Hieroglyphen und damit der Ägyptologie. Für die einschlägige digitale Forschung wird zudem eine Lösung zur semantischen Identifikation solcher Schriftzeichen entwickelt, für die in der akademischen Ägyptologie ohne eine solche Partnerschaft kaum adäquate Ressourcen in einem so kurzen Zeitraum bereitgestanden hätten. Durch die Kooperation wurden die Werkzeug- und Korpusentwicklung also entsprechend erheblich beschleunigt, wovon auch die Disziplin profitiert. Scholarly Makerspaces können an dieser Stelle als Showroom und Vernetzungsraum eine besondere Rolle spielen und vielleicht auch helfen, möglicherweise noch existierende Berührungsängste abzubauen. Wichtig ist aber sicher auch, dass sie die Frage spiegeln, was es eigentlich, auch für das Selbstverständnis von Wissenschaft, bedeutet, dass bestimmte Innovationen perspektivisch vermutlich nur in Partnerschaften mit außerakademischen, möglicherweise auch kommerziell orientierten Akteuren und mit entsprechend auch weniger wissenschaftlich ausgerichteten Zielstellungen realisiert werden können?
Wissenschaft und Öffentlichkeit sowie andere Bereiche der Gesellschaft nähern sich sehr offensichtlich zumindest dort an, wo mit ähnlichen Werkzeugen und Apparaturen agiert wird. Das die Datenanalytik in Unternehmensberatungen ebenso, wenn auch mit anderen Erkenntniszielen, auf semantische Analysen und die Modellierung sowie Visualisierung von Netzwerken setzt, überrascht wenig. Unklar ist jedoch, wie sich solche Entwicklungen und die beispielsweise in den Digital Humanities zueinander verhalten können und sollen.
Abgesehen davon sind auch inner- bzw. interdisziplinär sind gerade in den Geistes- und Kulturwissenschaften enge Verschränkungseffekte zu beobachten und zu erwarten. Wo sich Materialformen und Verfahren ähneln, drängt es sich auf, weitere Entwicklungen im engen Austausch zu betreiben und möglicherweise bewusster als bisher nach Ähnlichkeiten zu suchen. Dass Scholarly Makerspaces eine Rolle im Feld der Wissenschaftskommunikation und dies auch im Sinne eines Public Understanding of Scholarhip spielen können, das vielleicht besser sogar um eine “Innovationskommunikation” erweitert werden muss, liegt nah.
Mit den Hackathons, an denen gerade nicht nur Fontane-Expert*innen oder Gender Scholars teilnehmen, zeigt sich ebenso eine deutliche Erweiterung des Kommunikationsradius wie mit Online-Wörterbüchern wie dem Coptic Dictionary. Je digitaler die Ergebnisse, Erkenntnisse, Fragestellungen und das Material einer Wissenschafts-Community vorliegen, desto größer ist auch ihr Potential, eine Wirkung außerhalb der eigenen Domänen zu entfalten. Ein Merkmal dieser Entwicklung ist eine Pluralität der Zugänge. Der Datenbestand des Coptic Dictionary wird beispielsweise über eine Online-Plattform für eine Nutzung im Browser bereitgestellt und zugleich als Rohdatensatz, mit dem andere Forschende direkt in eigenen Lösungen weiterarbeiten können oder mit dem beispielsweise Entwickler*innen neue Lösungen und Anwendungen erarbeiten können. Wo eine standardisierte Datengrundlage und eine entsprechende Offenheit (Schnittstellen, Lizenzen) gegeben ist, eröffnen sich potentiell unbegrenzt neue Zielgruppen, woraus sich zugleich besondere Anforderungen an die Beschreibungen, Metadaten und Dokumentationen ergeben. Diese müssen in solchen Szenarien auch eine allgemeinere Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit vorbereiten, woraus sich möglicherweise gleich ein neues bibliothekswissenschaftliches Zukunftsthema ergibt. Denn dass neben der bloße Bereitstellung über GitHub oder Zenodo besondere Aufbereitungen auch redaktioneller Art und möglicherweise eingängigerer Plattformstrukturen notwendig sind, liegt auf der Hand. Für die Transformationsphase hin zu einer allgemeinen Niedrigschwelligkeit der Zugänge, sind Scholarly Makerspaces, jedenfalls aus unserer Sicht, passende Moderations- und Vermittlungsorte. Interessanterweise sahen wir diese Rolle zu Beginn des Projektes weniger stark gewichtet und gingen von einer deutlich konservativeren Ausrichtung des Angebotes aus. Besonders die Interviews und Workshops haben die Perspektive aber deutlich in diese Richtung erweitert. Sie spiegeln zugleich etwas, was an vielen Stellen in der Luft liegt.
Mit den Scholarly Makerspaces ergibt sich ein Vermittlungsort für die digitale Auseinandersetzung mit Kulturdaten und zwar sowohl für Lehre und Forschung als auch für die Schnittstelle, über die eine Vernetzung mit außerakademischen Akteuren erreicht wird, insbesondere auch hinsichtlich der Entwicklung von Werkzeugen, Algorithmen und Darstellungsmodi (Stichwort: Appifizierung).
Ausblick
Die Entwicklung und geplante Implementierung von Scholarly Makerspaces erfordert naturgemäß zugleich immer eine Balance zwischen dem Wünschbaren und dem Realisierbaren. Dies stellt sich lokal jeweils unterschiedlich dar. Im Zweifel muss man aber mit weniger Ressourcen rechnen und von einer stärkeren Zurückhaltung der Trägerinstitution ausgehen, als man es mit dem Schwung konstruktiver Workshop-Diskussionen gerne hätte. Die Scholarly Makerspaces als Produkt sind daher möglichst generisch und überschaubar zu denken. Der Baustein der Community-Entwicklung und -pflege ist ebenfalls von den lokalen Bedingungen abhängig und wird sich hinsichtlich des Potentials vermutlich erst während der ersten Betriebsphasen belastbar abschätzen lassen
Das stabile Basisprofil umfasst zwei Komponenten: Einerseits die Sammlung, Kuratierung, Bereitstellung und Erklärung von Anwendungen und Lösungen für die digitale Arbeit in den Geistes- und Kulturwissenschaften, also Werkzeuge (auf Workstations), beforschbare digitale Materialien, dokumentierte Workflows, Best-Practice-Use-Cases und ein Basiswissen sowie bei Bedarf Schulungen und Weiterbildungen. Der zweite Baustein liegt im Bereich der Beratung für den Einsatz digitaler Elemente in Lehre und Forschung sowie der Antragsplanung.
Ein Raum, Hardware, Software, eine Informationsplattform (Stichwort: Wissensmanagement) sind also die Grundelemente. Große Teile der Informationen können auch an zentral organisiert Stelle für mehrere Scholarly Makerspaces, beispielsweise in einer Art Verbund-Wiki oder auch einem anderen Wissensmanagementsystem gesammelt werden. Vor Ort kämen noch organisatorische Aufgaben (Betrieb, Veranstaltungen und Schulungen) sowie das Bedarfsmonitoring und die Erfahrungsdokumentation dazu. Dies würde einen Grundbetrieb (ausgenommen die Frage der Aufsicht) mit vergleichsweise überschaubaren Betreuungskapazitäten zum Beispiel durch eine/n DH-Librarian ermöglichen.
Dieses Basisausstattung setzte zugleich voraus, dass entweder über Projekte oder auch über eine höhere Dauerausstattung regelmäßig und begleitend ein Trendmonitoring, eine auch redaktionelle Materialaufbereitung, der Aufbau und die Pflege des Expert*innen-Netzwerks (Ansprechpartner*innen für spezifischere Fälle) sowie die Entwicklung von Kommunikationsstrategien abgesichert werden. Darin eingeschlossen wären ein Branding und die Leitbildentwicklung sowie das Erfassen und Adressieren von unterschiedlichen Anforderungs- und Erwartungsstufen mit ein.
Das tatsächliche Innovationspotential der Scholarly Makerspaces zeigt sich jedoch dort, wo sie über eine Ausrichtung eines Beratungs- und Supportdienstes hinausgehen, wie man ihn in vielen Einrichtungen von der Open-Access-Publikationsberatung und dem Forschungsdatenmanagements kennt. Als Prozessbegleiter (Facilitator) und -beschleuniger (Incubator), zugleich als Ort auch des institutionellen Lernens eröffnen die Scholarly Makerspaces buchstäblich einen Entfaltungsraum für den digitalen Kulturwandel in der Wissenschaft und mittelbar auch darüber hinaus. Sie sind damit mehr als ein zusätzlich Menüpunkt im Serviceprofil der Einrichtung, denn sie ermöglichen unterschiedlichen Communities und den angeschlossenen Einrichtungen die Möglichkeit, sich aktiv und kollaborativ in die digitalen Transformation von Wissenschaft, Wissensarbeit und Wissenskulturen einzubringen und sie damit wirksam mitzugestalten.
(Berlin, 20.11.2019)
von Michael Kleineberg und Ben Kaden
Gern sind wir einer Einladung in die Digital-Humanities-Werkstatt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) gefolgt, um Ende April die Zwischenergebnisse unserer Konzeptstudie vorzustellen. Zugleich hatten wir großes Interesse an dem neu eingerichteten Digital-Humanities-Lab in den Räumen der dortigen Universitätsbibliothek.
Die Veranstaltung vom 30. April 2019 diente also vor allem dem gegenseitigen Austausch von Ideen und Erfahrungen. Während unsere Konzeptstudie eher einen theoretisch-systematischen Ansatz verfolgt, entschied man sich an der FAU für einen pragmatischen Ansatz, um zunächst einmal die grundlegenden infrastrukturellen Bedürfnisse des ebenfalls neu eingerichteten Studienganges „Digitale Geistes- und Sozialwissenschaften“ zu adressieren.
Als „Interdisziplinäres Zentrum“ versucht das IZdigital (FAU) die digitalen Methoden aus mehr als zehn geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern zu bündeln und gemeinsam mit der Universitätsbibliothek und der Philosophischen Fakultät der FAU mit Infrastrukturangeboten und Beratungen zu unterstützen. Insbesondere das DH Lab kommt dabei unserer Idee der Scholarly Makerspaces bereits sehr nahe, da es sich als eine Kombination aus Helpdesk, Werkstatt und Open Space versteht. Das DH Lab nutzt einen Schulungsraum der Universitätsbibliothek mit 20 Computerarbeitsplätzen und vorinstallierten DH-Anwendungen und bietet einen festen wöchentlichen Termin zur Beratung und Schulung insbesondere für Studierende an.
In der Diskussion wurde deutlich, dass durchaus einige Hürden bei der Etablierung eines solchen Angebotes zur Vermittlung digitaler Forschungswerkzeuge bestehen. Dazu zählen unter anderem:
- die zeitlich beschränkte Nutzungsmöglichkeit des Raumes als DH Lab, zumal dessen Platzanordnung eher auf Frontalunterricht als auf Gruppenarbeit und sozialen Austausch zugeschnitten ist;
- die knappen personellen Ressourcen bei der Betreuung des DH Labs sowie die Schwierigkeit, Stellen mit enstprechenden IT-Kompetenzen zu besetzen;
- die fehlenden finanziellen Mittel zur Lizenzierung einschlägiger digitaler Werkzeuge und der Rechtfertigungszwang für deren Relevanz besonders in der Einführungsphase;
- die offenbar unzureichende Kommunikation des Angebotes in die Fakultäten und Institute, da es bislang eine nur geringe Kenntnis und Nutzung des DH Labs gibt;
- die Namensgebung „Digital-Humanities-Lab“ scheint einige potenzielle Nutzerinnen und Nutzer eher abzuschrecken, die sich nicht dezidiert der DH-Community zugehörig fühlen.
Diese Herausforderungen decken sich durchaus mit Einsichten unserer Anforderungs- und Bedarfsanalyse, wie wir sie in unserem Zwischenbericht vorgestellt haben. Einige weitere Aspekte unserer Konzeptstudie wurden dann auch aufgegriffen und intensiv diskutiert sowie als Anregung verstanden – zum Beispiel die Einbindung solcher Infrastrukturangebote in E-Learning-Plattformen oder die Ausweitung der Zielgruppen über die Studierenden hinaus.
Eine weitere sehr wichtige Erkenntnis ergab sich aus der Veranstaltung selbst, deren Publikum eine Bandbreite von Hintergründen – Informatik, Bibliothek, Digital Humanities, Studierende – repräsentierte: Die Perspektiven auf ein Angebot wie das DH Lab sind sehr unterschiedlich und müssen zunächst auch kommunikativ aufeinander zugeführt werden. Denn erst im wechselseitigen Verständnis erschließt sich das Potential einer inklusiven bedarfsgerechten Ausgestaltung derartiger Angebote.
Naturgemäß etwas selbstbezüglich erwies sich die Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Angebots selbst als ein Anliegen der Scholarly Makerspaces: dem Zusammenführen heterogener Sichtweisen und die aktive Verständigung über Themen der digitalen Forschung bzw. in unserem Fall der entsprechenden Infrastruktur. Das DH Lab der FAU Erlangen-Nürnberg ist aber auch darüber hinaus ein für unsere Studie sehr willkommener Use Case, weshalb wir den Austausch auch zukünftig unbedingt pflegen möchten.
In der neuen Ausgabe von LIBREAS. Library Ideas #35 (2019) ist unser Artikel „Scholarly Makerspaces – Ein Zwischenbereicht zum DFG-Projekt FuReSH“ erschienen.
Abstract:
An der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin wird aktuell eine Konzeptstudie zur Idee der sogenannten Scholarly Makerspaces erarbeitet. Mit diesem Ansatz soll die Vermittlung von Bausteinen der digitalen Forschung in den Kultur- und Geisteswissenschaften auch über den Kernbereich der Digital Humanities hinaus auf lokaler Ebene verbessert werden. Aus bibliothekarischer Sicht versteht sich die Idee zugleich als ein Angebot, um die Rolle von Universitätsbibliotheken in ihrem jeweiligen Bedingungs- und Wirkungsrahmen explizit als Partner der Forschung zu untersuchen und Möglichkeiten einer differenzierten Vermittlung so genannter digitaler Literarizitäten über den sehr allgemeinen Begriff der Informationskompetenz hinaus auszuloten. Aus Sicht der Entwicklung von digitalen Forschungswerkzeugen ermöglichen Scholarly Makerspaces einen besseren Zugang zu Zielgruppen in der Breite und damit neue Vermittlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten für Anbietende. Der Bericht dokumentiert den Zwischenstand anhand ausgewählter Aspekte. Die Gesamtstudie wird Ende des Jahres 2019 vorgelegt.
Beobachtungen zum GI-Workshop: „Im Spannungsfeld zwischen Tool-Building und Forschung auf Augenhöhe – Informatik und die Digital Humanities“ am 25.9.2018 in Berlin.
von Ben Kaden (@bkaden)
Die Beziehung zwischen Informatik und Geisteswissenschaften ist traditionell eine komplizierte. In den Digital Humanities finden beide disziplinären Felder zwangsläufig, wenn auch erfahrungsgemäß nicht immer zueinander, so doch wenigstens eine außerordentliche Nähe. Dass diese naturgemäß gegeben sein sollte, könnte man annehmen, wenn man es mit Frieder Nake hält, der, die Semiotik als Basis nehmend, betonte:
“Es handelt sich aber gleichzeitig um eine Sozial- oder Geisteswissenschaft, insofern die Informatik algorithmische Semiosen betrachtet.”
Allgemeine Erfahrungen deuten aber eher darauf hin, dass diese These von der Informatik als Geisteswissenschaft bislang im Alltag stärkeres Gewicht als konzeptionelles Gedankenspiel denn als Verständigungsgrundlage für die Digital Humanities erhielt. Vielleicht wird sich dies ändern. Vielleicht ist sie aber auch etwas zu radikal gefasst, um über die wissenschaftstheoretische Reflexion hinaus Wirkmächtigkeit zu entfalten.

Dass es auch über die Semiotik hinaus eine ganze Vielzahl von Ansätzen für eine Verständigungen zwischen Wissens- und Kommunikationskulturen von Informatik und Geisteswissenschaften gibt, legte im späten September ein außerordentlich konstruktiver Workshop der Gesellschaft für Informatik frei. Veranstaltungsort war passenderweise der Multifunktionsraum des interdisziplinären Exzellenzclusters Bild-Wissen-Gestaltung in der Berliner Sophienstraße. Dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden sogar kurzzeitig mit einbezogen und per Lunch Talk von Michael Piotrowski unter dem Titel “Digital Humanities: An Explication” mit dessen Thesen zur Modellbildung als Zentralgegenstand der theoretischen und praktischen Digital Humanities konfrontiert. Signifikant für die Digital Humanities, so der Ansatz, sollte ein “computational” bzw. “formal modeling” sein, dass sich in vielen Wissenschaften bewehrt hat. Nimmt man das Phänomen “Modell” also als Dreh- und Angelpunkt der Digital Humanities, dann kann man folgende Definition annehmen und zur weitereren Diskussion stellen:
“1. Research on and development of means and methods for constructing formal models in the humanities (theoretical digital humanities)
2. The application of these means and methods for the construction of concrete formal models in the humanities disciplines (applied digital humanities)”. (https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17004)
Wie konsensfähig dieser durchaus szientifizierend gerichtete Blick auf die sich oft bewusst und sicher auch aus guten Grund gegen eine Formalisierung sperrenden Geisteswissenschaften ist, blieb ein bisschen unscharf. Eine interessante und durchaus konsensfähige Erkenntnis des Workshops war aber, dass Digital Humanities auch oder gerade aus primär informatisch geleiteter Sicht keineswegs die natürlichen Nachfolge der Geisteswissenschaften wie wir sie kennen in einer Quasi-Evolution des Wissenschaftssystems darstellen. Sondern ein Forschungsprogramm ganz eigener Qualität.
Dies eindeutig abzugrenzen bleibt zugleich eine Herausforderung, zumal dennoch auch traditionelle Geisteswissenschaften mehr und mehr mit informatischen bzw. digitalkulturellen Konzepten, Ansätzen und Verfahren zu tun haben und zwar mindestens dort, wo sich ihr Gegenstandsbereich auf digitale Phänomene erweitert. Der Dialog mit der Informatik muss also so oder so zustande kommen. Der Workshop verdeutlichte erfolgreich, wie machbar und sinnvoll dies ist. Die sechs Vorträge sowie ein gutes Dutzend Poster lieferten den Input. Die jeweiligen Diskussionen und das Abschlussgespräch blieben sehr fokussiert und lieferten eine Reihe von Anregungen für eine weiterführende Reflexion. Entsprechend lassen sich aus diesem Workshop einige Trends und Desiderate festhalten und für Folgeüberlegungen zum Verhältnis von Informatik und Geisteswissenschaften sowie – in diesem Blog natürlich vorranging bedeutsam – zur Aufgabenbestimmung und Ausgestaltung von Scholarly Makerspaces beitragen sollten.
Trends Verhältnis Informatik und Geisteswissenschaften
Zusammenfassend lassen sich im Nachgang der Veranstaltung aus unserer Sicht fünf Trends für das Spannungsverhältnis von Informatik und Geisteswissenschaften identifizieren, wobei die ersten beiden eng miteinander verbunden sind.
1 Was ist der Gegenstand der Digital Humanities?
Sicher ist das Verhältnis von Informatik und Geisteswissenschaften keinesfalls auf die Digital Humanities zu reduzieren. Zugleich bieten diese jedoch einen Anwendungsfall, in dem diese Spannung besonders intensiv zum Ausdruck kommt und verhandelt wird. Die zentrale Fragestellung lautet, was der Gegenstand der Digital Humanities ist, sein kann und sein sollte? Es ist anzunehmen, dass mit ihr exakt die Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten freigelegt werden, die es ermöglichen, informatische und geisteswissenschaftliche Linien konstruktiv aneinander anzunähern. Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Modellbildung eine mögliche Antwort sein kann. Zugleich liegt jedoch die Stärke der Geisteswissenschaften im Umgang mit dem Uneindeutigen. Daraus folgte in diesem Szenario die Herausforderung, Uneindeutigkeit bzw. Unsicherheit so abzubilden, dass sie modellierbar und idealerweise auch informatisierbar ist. Derzeit scheint dies in vielen Fällen nur mittels einer erheblichen Reduktion, Vereinfachung und Schematisierung unter anderem auch der Forschungsfragen zu gelingen. Digitale Geisteswissenschaften, die dem folgen, müssen sich folglich auf die tatsächliche Aussagekraft und den wissenschaftlichen Mehrwert ihrer Erkenntnisse befragen lassen. Zentral ist zudem das Wissen darüber, welche Art von Forschung, Forschungsfragen und Forschungsmaterial adäquat mit digitalen Mitteln und Verfahren abgebildet werden kann und welche genuinen und relevanten geisteswissenschaftlichen Forschungsaspekte möglicherweise beim Einsatz bestimmter Verfahren verloren gehen.
2 Konflikt der Interpretation
Die vorgehend angesprochenen Grundfrage wiederholt sich in dem, was auch im Workshop unter der Bezeichnung “Konflikt der Interpretation” diskutiert wurde. Dass hierzu speziell aus der informatischen Perspektive eine Sensibilität feststellbar wurde, ist ein wichtiger Schritt, blieb dieser Aspekt doch bislang oft in einer Art konzeptionellen Black Box der Digital Humanities. Es geht um das Verhältnis der oft auf Operationalisierbarkeit qua Eindeutigkeit zielenden informatischen Perspektive und der mit dem ungewissen, mehrdeutigen befassten interpretativen Ansätze geisteswissenschaftlichen Forschung, also die Frage: Wie gehen wir mit dem Problem der Uneindeutigkeit, dem Anteil des Irreduziblem um, dass das Spezifikum geisteswissenschaftlichen Denkens und die große Hürde für jedes Bemühen um eine eventuelle Szientifizierung darstellt?
Generell herrschte Übereinstimmung, dass eine Informatisierung geisteswissenschaftlicher Forschung nicht das Ziel sein kann und sollte. Auf Algorithmen basierende digitale Forschung weist Potentiale für bestimmte Bereiche der geisteswissenschaftlichen Forschung auf. Dies ist jedoch eine Erweiterung, keine Ablösung. Auch perspektivisch wird es in den Geisteswissenschaften genügend Forschungsfragen, -konzepte und -verfahren geben, die nicht zwingend digital sein müssen.
3 Tools als Black Box
Eine Herausforderung für die Bildung eines gemeinsamen Verständnisses liegt darin, dass die aktuell verfügbaren Werkzeuge selten geisteswissenschaftlich reflektiert und vielmehr vor allem konkret funktional entwickelt wurden. Zugleich bleiben sie für zahlreiche, informatisch oft nicht umfassend geschulte Anwenderinnen und Anwender teilweise oder auch völlig eine Black Box. Möglichkeiten und Funktionsgrenzen sowie Fehler bei der Anwendung sind weitgehend unbekannt, weshalb eine methodischen Ansprüchen der Wissenschaft genügende Verfahrenstransparenz häufig nicht wirklich realisiert werden kann. Notwendig wäre folglich, dass Forschende, die Werkzeuge nutzen, prinzipiell überblicken und einschätzen können müssen, was diese Werkzeuge leisten und was nicht bzw. wie sich die Auswahl eines Werkzeugs auf die Ergebnisse auswirkt. Da dies meist nicht der Fall ist, entsteht die Gefahr, dass die Werkzeuge und nicht die Forschungsfragen Erkenntnisprozesse steuern. Die Ergebnisse wirken oft auf den ersten Blick überzeugend, können aber mangels Verfahrenskenntnis nicht auf ihre Validität oder Plausibilität hin geprüft werden. Daher scheint es notwendig, Werkzeuge deutlich stärker als bisher aus der Logik der Forschung und einer geisteswissenschaftlichen Perspektive zu entwickeln. Dies ist nur durch eine noch intensivere Kollaboration zwischen Entwicklern, der Informatik als Wissenschaft, den Geisteswissenschaften und der geisteswissenschaftlichen Methodologie umsetzbar.
4 Werkzeugentwicklung und Methodenentwicklung
Eine entscheidende Einsicht lautet, dass Werkzeugentwicklung immer auch Methodenentwicklung ist. Wie jede methodische Arbeit ist sie auch nie abgeschlossen. Sie sollte daher nie als reine Produktentwicklung verstanden werden. Iteration und Reflexivität sind hierbei Stichworte. Dabei geht die Methodenentwicklung einer Werkzeugentwicklung eher voraus, weil ihre Anforderungen den Zielrahmen der Gestaltung von Tools darstellen. Zugleich setzt aus der Natur der Werkzeuge das Faktische der Machbarkeit. Digitale Methoden können sich nur innerhalb des Rahmens digitaler Möglichkeiten bewegen. Um dieses wechselseitige Elaborieren von Methoden und Tools handhabbar und flexibel zu halten, wird davon abgeraten, komplexe Softwareumgebungen anzusteben. Angemessener erscheinen eher einfache, technologisch weitergehend standardisierte und dafür in ihre Funktion und Reichweite transparente Werkzeuge für bestimmte überschaubare Einzelschritte geisteswissenschaftlicher Forschung.
5 Human-Computer-Interaction als verbindendes Element
Zumindest für den Stand der aktuellen Entwicklung wird das Feld der sogenannten Human-Computer-Interaction (HCI) als mögliches Verbindungsglied zwischen Informatik und Geisteswissenschaften gesehen. Bislang spielen digitale Werkzeuge ihr Potential vor allem an im Bereich Materialerschließung bzw. -durchdringung sowie der daraus folgenden Abbildung von Mustern, Strukturen und Netzwerken aus. Die entsprechenden Werkzeuge lassen sich daher stärker als wahrnehmungserweiternd ansehen. So helfen sie beispielsweise, eine aufgrund von Close Reading entwickelte Hypothese mittels Distant Reading auf einen großem Korpus zu prüfen, ein Ansatz, den man auch Mixed Reading nennt. Human-Computer-Interaction steuert in diesem Zusammenhang die Annäherbarkeit an das Material. Die Bedingungen dieser Annäherung müssen folglich ebenfalls sichtbar werden. Die Gestaltung der Interaktionsoptionen, also das Werkzeugdesign mit dem Anspruch an maximale Transparenz auch für die Anwenderinnen und Anwender anzustreben, erfordert notwendig denn vielfach eingeforderten Dialog zwischen Werkzeugentwicklung und Werkzeugnutzung. Zugleich stellt die Vermittlung informatisch verarbeiteter geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten eine wichtige Facette der digitalen Forschung dar, bei der die Vorteile solcher Verfahren besonders sichtbar werden. Vom Workshop ging das deutliche Signal aus, den Bereich der HCI noch zentraler als bisher zu behandeln und als Bezugspunkt für entsprechende Entwicklungen heranzuziehen.
Desiderate
Parallel zu den Trends lassen sich Desiderate für ein weiteres Vorgehen im Dialog der jeweiligen Communities benennen.
1 Dialog und “Hohe Rösser”
Ein sehr greifbares Ergebnis der Veranstaltung war die Einsicht in die Notwendigkeit, jede Form einer sogenannten “Facharroganz” abzulegen, also eventuelle Überlegenheitsgefühle den anderen Communities gegenüber. Sie ist unnötig, unsachlich und erfahrungsgemäß die entscheidende Hürde, die einer Verständigung im Weg steht. Eine wechselseitige Wahrnehmung steht naturgemäß unter einer Spannung, die sich teilweise eben auch darin zeigt, dass die Relevanz der Forschungs- und Entwicklungsziele sowie Verfahren der jeweils anderen Community nicht als gegeben und gleichwertig annimmt, sondern permanent gegen die (vermeintliche) eigene gewichtet. Es handelt sich folglich auch um eine wissenschaftssoziologische Problemstellung, für die Lösungsstrategien gefunden werden müssen. Die Informatik ist keine der Universität angehängte Werkbank für die Entwicklung von Apps (und Spin-Offs), sondern eine eigenständige Wissenschaft mit eigenständigen Forschungszielen. Und die Geisteswissenschaften sind keine ziellose und unkonstruktive Veranstaltung der schöngeistigen Bespiegelung von Trivialitäten, sondern ein epistemologischer Grundpfeiler der Kultur.
2 Erwartungshaltungen
Erwartungshaltungen wären ebenfalls auf allen Seiten auf ein realitätsnahe Maß zu regulieren. Die Geisteswissenschaften neigen einerseits oft dazu, die Möglichkeiten der Informatik zu überschätzen. Besonders gelungene Visualisierungen sorgen häufig für eine initiale Begeisterung, auf die jedoch immer eine kritische methodische Evaluation des Gezeigten folgen muss. Andererseits wurde ausgeführt, dass die Geisteswissenschaft in digitalen Werkzeugen häufig nur eine Weiterführung etablierter geisteswissenschaftlicher Verfahren mit digitalen Mitteln sehen und zu wenig realisieren, dass dies bereits konzeptionell nicht unbedingt möglich ist und sich andererseits die Informatik in dieser Wechselbeziehung keinesfalls auf die Rolle eines Zulieferes beschränken möchte. Zumindest für die Digital Humanities bedeutet die Hinzuziehung des Digitalen eine grundständige Neubewertung aller Aspekte der geisteswissenschaftlichen Forschung. Bestehende Kooperationen werden leider in vielen Projekten, so die Wahrnehmung im Workshop, von der geisteswissenschaftlichen Seite als eine Art Service-Level-Agreement verstanden. Tatsächlich werden sie aber nur als interdisziplinäre Kooperationen auf der für den Workshop titelgebenden „Augenhöhe“ gewinnen. Die Informatik ist nicht Dienstnehmer, sondern Forschungspartner der Geisteswissenschaften, wobei sie dieses Rollenverständnis mitunter deutlicher kommunizieren und leben muss.
Die Informatik muss folglich ebenfalls ihre Erwartungshaltungen reflektieren. Sie scheint generell in diesem Zusammenhang zu stark auf technische Aspekte ausgerichtet und blendet die Ansprüche und Ziele geisteswissenschaftlicher Forschung zu häufig ab. Sie kann beispielsweise Daten zwar auf ihre technische Güte, selten jedoch auf ihre Relevanz für geisteswissenschaftliche Fragestellung bewerten. Die oft nicht linearen, “unscharfen” geisteswissenschaftlichen Erkenntnisprozesse sind InformatikerInnen häufig nur sehr schwer zu vermitteln, auch weil auf dieser Seite die prinzipielle Offenheit dafür fehlt.
Sollen schließlich “Modelle” der Gegenstand digitaler Geisteswissenschaften werden, wären zunächst die sich erheblich unterscheidenden Vorstellungen von dem, was ein “Modell” ist, abzugleichen und anzunähern. Es muss hier wie auch generell ein geteiltes Verständnis möglicherweise sogar von Wissenschaft dialogisch und konsensuell erarbeitet werden. Eine verbindliche gemeinsame begriffliche Basis von Informatik und Geisteswissenschaften ist nach wie vor ein Desiderat.
3 Wissenstransfer zwischen Informatik und Geisteswissenschaften
Erforderlich wird daher für die digitale geisteswissenschaftliche Forschung ein ständiger Wissens- und Perspektivenaustausch zwischen Informatik und Geisteswissenschaften. Für die Informatik bedeutet dies unter anderem, dass sie sich stärker auf quellenkritische Ansätze einlässt. Dies betrifft ausdrücklich auch die Analyse von Werkzeugen, Algorithmen und Code. Eine Leitfrage wäre beispielsweise die nach spezifischen (kulturellen) Dispositiven, die den jeweiligen Code prägen und die dieser reproduziert. Die Digital Humanities sind in dieser Hinsicht auch als Kritische Informatik vorstellbar.
Die Geisteswissenschaften zeigen sich dagegen ausgerechnet digitalen Technologien häufig undifferenziert entweder zu ablehnend oder zu affirmativ, was in der Vergangenheit dazu führte, dass digitale geisteswissenschaftliche Forschung sehr Buzzword-getrieben und auf Kurzzeittrends ausgerichtet erschien. Aktuelle Konzepte, z.B. “Machine Learning” werden unkritisch und ohne ein tieferes Verständnis für die Funktionsbedingungen und Implikationen in den Diskurs und Entscheidungsprozesse übernommen.
Eine Herausforderung liegt zudem in der Zuständigkeit für die Vermittlung zwischen den beiden Perspektivgruppen. Der Workshop zeigte, dass es sowohl informatisch Forschende mit einem großen Interesse und auch Verständnis für geisteswissenschaftliche Bedingungen gibt als auch umgekehrt. Zugleich sind dies nach wie vor Ausnahmen. Ein Grundproblem besonders der Digital Humanities ist traditionell die Rückbindung der Gestaltung und Weichenstellung an einzelne Personen und deren individuelle Interessen. So wichtig dies in der Frühphase der Herausbildung eines solchen disziplinären Paradigmas ist, so notwendig ist mit der Reifung des Forschungsfeldes, dass der eher kontigente Grundaufbau als Community stabilisiert und konzeptionell sowie methodologisch systematisiert wird. Dazu werden Akteure benötigt, die grundständig sowohl geisteswissenschaftlich als auch informatisch ausgebildet sind. Eine Hoffnung liegt aktuell auf den seit einiger Zeit eingerichteten DH-Studiengängen, aus denen entsprechende Expertinnen und Experten hervorgehen sollen. Ungeklärt ist mangels Erfahrungswerten, ob diese der auf sie projizierten Rollenerwartung auch gerecht werden können.
Als ein anderer, vermutlich auch ergänzender Weg wäre, innerhalb der Lehre sowohl der Informatik als auch der geisteswissenschaftlichen Methodenausbildung entsprechende Aspekte aus den anderen Denkkulturen zu vermitteln. Das Ziel ist nicht, dass Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler auf breiter Front programmieren lernen. Aber sie sollten verstehen, wie Programme und Algorithmen funktionieren und was es bedeutet, eine Korpus mit einer entsprechenden Software auszulesen. Der Informatik wird angeraten, stärker auch kritische und reflexive Verfahren zu vermitteln. In den Geisteswissenschaften sollte ein besseres Verständnis für die Bausteine digitaler Verfahren sowie den Stärken und Grenzen der Anwendung entsprechenden Methoden und Werkzeuge generell und konkret für die geisteswissenschaftliche Forschung vermittelt werden.
4 Förderstrukturen
Als erheblicher und nachhaltige Forschung und Entwicklung bremsender Aspekt wurden die Förderstrukturen benannt, die nicht der Komplexität der sich aus der Wechselbeziehung von Informatik und Geisteswissenschaften ergebenden Forschungsfragen gerecht werden. Der Workshop zeigte, dass, zumindest aktuell weitaus mehr auf Methoden und theoretische Grundlagen gerichtete Forschung notwendig ist, als solche, die konkrete Resultate und Produkte adressiert. Es wird eine erhebliche Notwendigkeit bei einer Digital-Humanities-Grundlagenforschung gesehen, die unter bisherigen Förderbedingungen jedoch kaum leistbar ist. Ein Stichwort lautet hier “Geduld”. Derart grundlegende Entwicklungen brauchen Zeit zum Reifen und Ausdifferenzieren. Diese ist in der Forschungspraxis allerdings nicht immer gegeben.
5 Wissenschaftliche Qualitätssicherung
Ein großes Desiderat liegt schließlich in der Sicherung der wissenschaftlichen Qualität bei digitaler, also werkzeuggestützter geisteswissenschaftlicher Forschung. Forschungstransparenz, die Bewertung der Datenqualität und der Relevanz der Forschungsergebnisse, die Sicherung der Nachnutzbarkeit und Anschlussfähigkeit der Forschung stehen in vielen Fällen nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie sollten es aber, denn nur wenn digital geprägte Wissenschaft mindestens das Qualitätsniveau der vorhergehenden Wissenschaftsformen hält, wird sie auch Akzeptanz finden. Die Herausforderungen für eine entsprechende Qualitätssicherung sind enorm. Oft stellt schon die Frage der Verfügbarkeit von qualitativ zureichenden Forschungsdaten für eine digitale, algorithmisierte Verarbeitung bzw. entsprechende Beforschung ein erhebliches Problem dar.
Es fehlen in vielen Fällen geeignete Korpora um überhaupt tragfähige Basisforschung zu leisten. Zugleich mangelt es sehr häufig an verlässlichen Vergleichs- und Normdaten. Im Fehlen entsprechender qualitätssichernder Elemente wurde explizit die Gefahr eines “Cliocide” der Digital Humanities gesehen.
6 Urheberrecht
Schließlich bleiben wie in allen digitalen Bereichen auch rechtliche Fragen und insbesondere das Fehlen eindeutiger Regelungen eine Herausforderung. Exemplarisch sei hier nur das Urheberrecht benannt, dass sehr häufig Zugriff und Nutzung, oft auch Aufbereitbarkeit von für digitale geisteswissenschaftliche Arbeit erforderlichen Forschungsdaten im Weg steht. Im Workshop wurde dieses Minenfeld nur am Rande angesprochen und die Erfahrungen zeigen, dass dies auch sinnvoll war. Die Komplexität dieses Bereiches erfordert noch einmal eine gesonderte Annäherung.
Ausblick: Die mögliche Rolle der Scholarly Makerspaces
Für die Scholarly Makerspaces, wie wir sie im FuReSH-Projekt untersuchen, gibt es eine Reihe von Anknüpfungspunkten, die sich naturgemäß auf die Fragen der Vermittlung besonders auch in der Lehre konzentrieren. Sie können als Anlaufpunkt für Studierende der Geisteswissenschaften Test- und Berührungsfläche und Reflexionsraum für die oben angesprochenen Aspekte sein. Gleiches gilt für Studierende der Informatik, die hier mit den Beschränkungen und Herausforderungen von Forschungswerkzeuge für digitale Geisteswissenschaften konfrontiert werden. Idealerweise eignen sich die Scholarly Makerspaces als Begegnungsort und Unterstützung eines interdisziplinären Dialogs zu den benannten Fragestellung.
Darüberhinaus sind sie als Raum innerhalb der Hochschule denkbar, indem zieloffen und explorativ die Wechselwirkungen von digitalen und geisteswissenschaftlichen Denkweisen und Phänomenen adressiert werden können. Unabhängig von Projektlaufzeiten und als Teil des Serviceangebots der Universitätsbibliothek könnte sich ein Kompetenzzentrum oder auch – im besten Sinne des Gedankens der Makerspaces – ein Treffpunkt exakt für die hier thematisierten Fragen herausbilden. Die Nutzerinnen und Nutzer des Scholarly Makerspaces, die keinesfalls nur Studierende, sondern alle, die an der Wechselbeziehung zwischen digitalen Werkzeugen, geisteswissenschaftlicher Forschung und allgemein der Auseinandersetzung mit digitalen Bibliotheksbeständen interessiert sind, erhalten mit dem Angebot eine Möglichkeit, ergebnisoffen und explorativ Kompetenzen zu erwerben, Material zu durchdringen und weiterführende Fragen zu entwickeln. Um dafür zugänglich zu sein, ist für die Makerspaces ein Komplexitätsmanagement dahingehend notwendig, dass sie einerseits niedrigschwellig nutzbar und inklusiv sein sollten und andererseits konkret und relevant für die sich entwickelnden Positionen zum Wechselverhältnis von Informatik, Geisteswissenschaften und natürlich der Bibliothek als drittem Akteur, der idealerweise das notwendige Forschungsmaterial in digital nutzbarer Form vorhält und/oder vermittelt. Der Workshop hatte diese denkbare Rolle der Bibliothek als drittem Baustein nicht im Blick. Entsprechend nehmen wir als FuReSH-Projekt die Aufgabe mit, diese Rolle stärker sichtbar zu machen.
(Berlin, Oktober 2018)