Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
1.
Im Juli fragte ich in einem Blogposting Gibt es Schnittmengen zwischen digitalem Journalismus und digitaler Wissenschaftskommunikation? und bot als Antwort ein gewisses Ja an. Gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften, bei denen Analysen sehr narrativiert kommuniziert werden, liegt die Parallele nah. (Ein schönes Beispiel für narrative Grenzgänger bietet unter anderem die, nun ja, Reportage-Studie Floating City von Sudhar Venkatesh, vgl. ausführlicher und auch hier). Das Herz des Journalismus schlägt wenigstens mit einer Kammer genau an dieser Stelle, die man gemeinhin Storytelling nennt. Auch die andere Kammer, die so genannten Listicles und anderen Metakuratierungen bestehender Webinhalte, sind gleichfalls ein Ansatz, der sich im Kontext von Meta- und Overlay-Journals in den Kontext wissenschaftlicher Publikationskulturen einbringen lässt, wobei Buzzfeed natürlich nur sehr bedingt ein direktes Vorbild sein sollte.
Kurioserweise ist das Buzzfeed-Modell das aktuell erfolgreichste Orientierungsmuster für den digitalen Journalismus, wie die Fachexpertin Emily Bell in einem aktuellen Interview gleich mehrfach betont. Spannend ist hier der Aspekt der Arbeitsteilung bei der Aufbereitung von Inhalten:
„Es gibt einen «Optimisation Desk» mit Spezialisten, welche die Artikel für die Distribution in den sozialen Medien anpassen und den Redaktoren zeigen, wie sie Überschriften zu texten haben, damit eine Story möglichst oft mit anderen Nutzern geteilt und «geliket» wird. Wenn ein Artikel viral wird, sich in den sozialen Netzwerken also wie eine Epidemie verbreitet, dann erreichen Sie nicht Tausende von Userinnen und Usern. Nein, mehrere Millionen. Die Sharing- und Liking-Ökonomie verändert alles, was wir Journalistinnen und Journalisten tun.“
Traditionalisten der geisteswissenschaftlichen Fachkommunikation läuft es gemeinhin bei derartigen Vorstellungen einer Vermittlungsoptimierung nicht ganz unberechtigt eiskalt den Rücken herunter. Für die Wissenschaft würde die Optimierung vermutlich weniger offensichtlich auf Clickbaiting abzielen. Sollten sich Altmetrics, die Impact eben auch genau in diesen Kanälen der digitalen sozialen Netzwerken zu messen versuchen, populärer werden, könnte sich das ändern.
Am Ende geht es hier wie dort um das Lenken von Aufmerksamkeit. Die besondere Fassung der Kommunikationsmöglichkeiten z.B. von Twitter erfordert denn auch tatsächlich spezifische Vermittlungsaufbereitungen. Die Vertreter der Wissenschaftsgemeinschaften, die diese Werkzeuge aktiv nutzen, folgen selbstverständlich den dort üblichen Prinzipien. Im Gegensatz zum Journalismus ist freilich bislang noch nicht erkennbar, dass es übergeordnete Akteure, zum Beispiel Wissenschaftsverlage, darauf anlegen, dies systematisch zu optimieren bzw. oft meist nicht einmal systematisch zu nutzen. Man kann es angesichts der Unschärfe der Zielgruppe und weitgehend fehlender Beispiele für Viralitätseffekte einschlägiger Fachpublikationen vermutlich auch noch nicht erwarten. Das kann sich aber ändern. Die Fachkommunikation der Wissenschaftsgemeinschaften hat gegenüber dem Alltagsjournalismus immerhin den Vorteil, selbst in den Bereichen mit maximal kurzer Halbwertszeit um Dimensionen langsamer operieren zu können. Das lässt prinzipiell Spielräume für (Selbst-)Reflexion, Analyse und schließlich bedachteres und nachhaltigeres Handeln, sofern es auch Akteure gibt, die genau dies für die Wissenschaftsgemeinschaften tun.
2.
Ein anderer Aspekt, der aus dem Feld des digitalen Journalismus in das des digitalen wissenschaftlichen Publizierens zunehmend rücken könnte, ist der der „developing story“, also des Abbildens von Forschung im Prozess. Der primäre Anwendungsfall sind seit je Konferenzen. Denkt man das Prinzip aber entschleunigter, so eignet es sich auch für Forschungsprojekte aller Art. Und in der Tat pflegen nicht wenige Projekt ein Begleitblog. Es sind aber auch weitaus elaborierte Abbildungsformen für Erkenntnisfortschritte denkbar. Ein früher Anwendungsfall könnte Christian Heises offene Dissertation sein. (Ein Experteninterview mit Christian Heise, das im Rahmen des Fu-PusH-Projektes entstand, ist hier verfügbar.) Auch hier ist die Entwicklung noch zu frisch, um überhaupt nach Standards zu suchen. Es wird hier und da ein wenig experimentiert, aber am Ende sind die Fragen einer möglichen Repräsentation der Forschungsergebnisse meist dem eigentlichen Forschungsanliegen weit nachgeordnet.
Ändern könnte sich das, wenn Virtuelle Forschungsumgebungen wirklich umfassend zum Einsatz kommen und entsprechende Tools für eine dynamische und öffentlich Forschrittsdokumentation mitliefern. Für die digitalen Geisteswissenschaften bedeutet dies aber auch, die Rollen innerhalb der Forschungsteams neu zu definieren, was zurück zum digitalen Journalismus und Emily Bell führt. Sie geht davon aus, dass eine stark auf Digitaltechnik setzende Form von Journalismus zwangsläufig auch zu einer Arbeitsteilung führen muss:
„Wir müssen zu Teams kommen, in denen die eine Hälfte aus Reportern mit klassischen Skills besteht, die andere Hälfte aber aus Programmierern, die für die Recherche Daten analysieren, dann Daten visualisieren und die schliesslich bei der digitalen Distribution der Beiträge mithilfe von Zugriffsanalysen eine maximale Reichweite garantieren.“
Insofern gibt es eine, wenn man so will, digitale Laborifizierung nicht nur in den Geisteswissenschaften unter dem Label der Digital Humanities (vgl. dazu auch hier), sondern auch im Journalismus, in dem man vielleicht eher auf das Motiv der „Assembly Line“ setzen würde. Im Fachdiskurs der Bibliothekswissenschaft hatte sich übrigens Walther Umstätter sehr intensiv und vielleicht etwas zu früh und vielleicht auch etwas zu fokussiert für die Fließbandproduktion in der Wissenschaft (PDF) eingesetzt. (Umstätter, 2001) Für ihn bedeutete die Entstehung der „Digitalen Bibliothek“, eine Art begriffliches Pendant zu den Digital Humanities, das sich freilich in weiten Teilen überlebt hat, da wir es im akademischen Rahmen häufig mit postdigitalen Bibliotheken zu tun haben, den Schritt zu einer neuen, stärker synoptisch ausgerichteten Beschäftigung mit wissenschaftlichen Inhalten bzw. Wissen:
„Die Digitale Bibliothek, deren Produktion wir nun begonnen haben, erfolgt sozusagen am virtuellen Fließband. Dabei erscheinen die Copyrights von etwa 80 Jahren zunächst als eines der größten Probleme bei der Reduplikation des Wissens. Sie werden aber fast problemlos überwunden durch die einzige Möglichkeit alles neu und zeitgemäß zu überarbeiten. Wir schreiben nicht einfach ab, wir fassen inhaltlich neu zusammen. Nicht unerwähnt bleiben darf dabei, die Tatsache, dass gerade die neuesten Erkenntnisse in einer heranwachsenden Generation immer wieder dazu führen, dass sich einige wenige Prozent der Wissenschaftler an die Arbeit machen müssen, auch längst vergessene Erkenntnisse unter dem Blickwinkel neuster Wissenschaft zu beleuchten und zu hinterfragen. Im Zusammenhang mit der Digitalen Bibliothek haben wir nun auch eine völlig neue Form der Wissensdarstellung, in der über die klassische buchzentrierte Bibliothek hinaus, auch die Virtuelle Bibliothek wirksam wird. Wir sind nicht mehr allein an das Papier gebunden, können Texte, Bilder und Tonaufzeichnungen hypermedial im World Wide Web vernetzen, können komplexe Modelle und Simulationen erzeugen und Expertensysteme mit Wissensbanken ausrüsten, wir können sie sozusagen simultan und interaktiv gestalten.“ (Umstätter, 2001, S. 193)
Die Urheberrechtsfrage bleibt auch heute als Hürde – Stichwort verwaiste Werke. Die technischen Möglichkeiten lassen dagegen sehr vieles aus diesem Szenario zu. Interessant ist auch, dass die Digital Humanities tatsächlich besonders im Editionsbereich greifen, wobei die Auswahl der Forschungsobjekte auf der Oberfläche nicht unbedingt das Umstätter’sche Kriterium des „längst vergessen“ bedient. Die Hoffnung ist allerdings, dass sich durch die digitale Tiefenerschließung wirklich neue Positionen und Analysegrade zum jeweiligen Werkkorpus ermitteln lassen.
3.
Die Idee der Digitalen Bibliothek wurde in der Zeit um 2000 verständlicherweise weitgehend aus einer retrodigitalisierenden Perspektive gedacht. Für die gegenwärtigen Geisteswissenschaften und alle Forschungs- bzw. Referenzgegenstände, die born digital sind, dürfte dieser Komplex auch bibliothekswissenschaftlich noch einmal neu aufzurollen sein. So scheint derzeit weitgehend ungeklärt, ob Objekte rein digitalen Ursprungs einfacher oder schwieriger in diesen Analyse- und Langzeitarchivierungsstrukturen verarbeitbar sein werden.
Für das erweiterere Publizieren sind die Ideen Walther Umstätters zwar sehr allgemein, in der Grundrichtung aber durchaus im Einklang mit dem, was aktuell angedacht wird: Abschied vom Paradigma des gedruckten Buches, Multimedialität, Vernetzung, Simulation und Visualisierung und schließlich Wissensbanken und Expertensysteme, die ihre Umsetzung möglicherweise in Lösungen aus dem Semantic bzw. Pragmatic Web finden werden. Die Entwicklung hin zu einer Technisierung der tiefen Verarbeitung von Inhalten (bzw. Narrativen) ist generell gegeben. Die auf Medienobjekte (bzw. Content) gerichteten Geistes- und Kulturwissenschaften, auf Narrativität setzende soziologische Ansätze und der Journalismus zwischen Kuratierung und genuinem Storytelling (bzw. Reportagen) unterliegen hier ähnlichen Transformationen. Der Reifegrad dieses Wandels entspricht in etwa der Trägheit der jeweiligen Kommunikationsgemeinschaften sowie dem Bereitschaft, in neue technologische Lösungen und auch Experimente zu investieren.
Naturgemäß ist die Nachrichtenindustrie an diesem Punkt weitaus schneller unterwegs. Es wird sicher noch Jahre dauern, bis auch in Forschungsgruppen die Fertigkeit zur Reichweitenoptimierung nachgefragt wird. Die Idee ist aber weniger abwegig, als es angesichts der Idealvorstellung von wissenschaftlichen Kommunikationsgemeinschaften scheint. Man kann den Disseminationsaspekt nicht zuletzt auch informationsethisch interpretieren und gelangt dann sehr schnell zum Konzept von Open Access bzw. Open Scholarship. Und sehr berechtigt fragt man sich derzeit besonders auch an den Bibliotheken als zentralen Dienstleistungsinstitutionen der Wissenschaft, inwieweit die komplexer werdenden Forschungs- und Publikationsaufgaben beim Einzelwissenschaftler perspektivisch noch zusammenlaufen können oder sollen. In den Geisteswissenschaften geht man an vielen Stellen nach wie vor davon aus, dass ein Indiviuum forscht und zugleich die Forschungspublikationen oft bis zur Druckvorstufe aufbereitet. Es ist offensichtlich, dass bei solchen Szenarien einerseits alle Bereiche eher an Qualität verlieren und dass sich andererseits kaum die Bereitschaft finden wird, beim Publizieren über halbwegs leicht zu überschauende Minimalstandards hinauszugehen. Zeitgemäßes digitales Publizieren ist unter diesen Bedingungen kaum möglich. Es wird folglich nicht ohne Arbeitsteilung gehen und das von Emily Bell benannte Verhältnis scheint auch für die Wissenschaft zutreffend:
„Das Verhältnis von Schreibern und Technikern, Digitalexperten muss 1 : 1 sein.“
Es bleiben zwei Fragen. Die erste dreht sich organisational um die (Schaffung von) Stellen von Digitalexperten/Mediengestaltern etc., die bisher im wissenschaftlichen Bereich nur sehr bedingt und wenn, dann meist als Entwicklerstellen vorliegen. Die zweite umkreist die Herausforderung, überhaupt adäquat qualifizierte Experten in die Geisteswissenschaften zu bringen. Passion und freiwillige Weiterbildung passen nicht zur Vorstellung systematischer Forschungsentwicklung. Die allesamt noch sehr jungen Digital-Humanities-Studiengänge werden dafür hoffentlich demnächst eine Antwort, in jedem Fall wichtige Erfahrungswerte liefern.
(Berlin, 02.11.2015)
Quellen:
Emily Bell, Michael Marti (2015): «Zeitungen sind zäh. Sie sterben langsam». In: 12app.ch. http://desktop.12app.ch/articles/22368360
Walther Umstätter (2001): Die Nutzung des Internets zur Fließbandproduktion von Wissen. In: Organisationsinformatik und Digitale Bibliothek in der Wissenschaft: Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2000 / Klaus Fuchs-Kittowski; Heinrich Parthey; Walther Umstätter; Roland Wagner-Döbler (Hrsg.). Mit Beiträgen von Manfred Bonitz … – Berlin: Gesellschaft für Wissenschaftsforschung 2001. S. 179-199
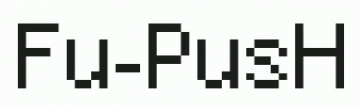


Auch im Definitorischen finden sich durchaus Parallelen zwischen dem digitalen bzw. Datenjournalismus und den Digital Humanities:
meint die Datenjournalistin Vanessa Wormer im Interview auf Code for Germany: Code for Journalism.
Pingback: Wie langzeitarchiviert man Enhanced Publications? | Future Publications in den Humanities
Pingback: Publikationskulturen und Urheberrecht. Eine Überlegung zu einem Differenzierungsansatz | Future Publications in den Humanities
Vielen Dank für die beiden Quellen, sehr interessant! Leider finde ich den zweiten Artikel nicht in meiner Bibliothek 🙁
Falls es noch relevant ist: Der angeführte Beitrag von Walther Umstätter ist über diesen Link als PDF verfügbar.