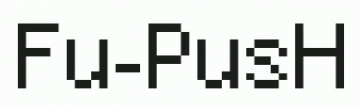Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
Beschäftigt man sich mit der Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens, so ist – derzeit jedenfalls noch – von großer Bedeutung, welche Vorstellungen die Wissenschaftsverlage, tradierte Intermediäre zwischen den Publikationen und den Bibliotheken als Großabnehmern, von dieser haben. Wenn nun Anke Beck, Geschäftsführerin des Verlages Walter De Gruyter, im Berliner Bibliothekswissenschaftlichen Kolloquiums (BBK) des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin die „Positionierung eines mittelständischen Verlages“ in der aktuellen wissenschaftsverlegerischen Landschaft beschreibt, ist das folglich ein vielversprechender Termin. Und in der Tat erhielt man als Beobachter einen sehr guten Einblick in das Denken, Planen und Selbstverstehen solcher Akteure.
Anke Beck mühte sich sichtlich, eventuellen Vorurteilen und nicht nur positiven Einschätzungen präventiv entgegenzuwirken, die nicht zuletzt während der recht offensiven und öffentlichkeitswirksamen Umstrukturierungen durch ihren Vorgänger Sven Fund gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich und auch im Bibliothekswesen entstanden. De Gruyter, so betonte sie, sei ein Familienbetrieb, dem es gerade nicht um die Erhöhung des Shareholder-Value ginge und der auch jeder Börsenhandelslogik enthoben wirtschaften kann. Damit macht er jährlich etwa 50 Millionen Euro Umsatz. Im Vergleich zu den wirklich großen Verlagen, Springer und Elsevier zum Beispiel, ist das nicht nur auf dem Tortendiagramm, mit dem die Betonung der Überschaubarkeit unterstrichen wurde, wenig. Sondern auch objektiv. Mit 300 MitarbeiterInnen besitzt De Gruyter etwa die Größe des Wiener Springer Verlags. Diese sorgen dafür, dass u.a. 1300 Buchtitel im Jahr und 700 laufende Zeitschriften erscheinen und die 40 Datenbanken gepflegt werden. Im Vergleich zu anderen mittelständischen Wissenschaftsverlagen in Deutschland ist das wiederum gewaltig.
Mittlerweile liegen die Wirtschaftszahlen des deutschen Buchhandels für das Jahr 2014 vor und werden heute eifrig in der Presse referiert. Unter anderem berichtet der Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass das Ende der Trilogie Shades of Grey eine spürbare Delle im Gesamtumsatz hinterließ. Spannender aus Fu-PusH-Perspektive ist jedoch ein anderer Aspekt: von den in Deutschland verkauften E-Books sind offenbar nur 6 % dem Bereich Sachbücher zuzuordnen. Die Zeitung merkt dazu an:
„Das deckt sich mit Erfahrungen von Fachbuchverlagen, wonach vor allem Lehrbücher immer noch zu 90 Prozent als gedruckte Ausgabe gekauft werden, weil man sich so besser einen Überblick über den Inhalt verschaffen und mit ihm aktiv arbeiten kann (Anmerkungen, Hervorhebungen, Hinweise).“
Das kontrastiert ein wenig das Leitnarrativ, welches der Verleger Matthias Ulmer 2009 in der Frühphase des Konfliktes um die Digitalisierung von Bibliotheksbeständen für die Nutzung an elektronischen Leseplätzen in Bibliotheken (§ 52b UrhG) in einem Brandartikel im Boersenblatt begründete. Er schrieb:
„Seit vergangener Woche ist das Lehrbuch in Deutschland tot.“
Sechs Jahre danach muss man sagen: Es lebt offenbar. Vielleicht liegt das auch daran, dass das ebenfalls sehr plastisch modellierte Szenario
„Der Buchhändler vor den Toren der Uni geht vor seinen Auslagen auf und ab und wundert sich. Nach der Vorlesung strömen die Studenten nicht zu ihm, um die Literatur für das Semester zu kaufen, sie strömen mit gezücktem USB-Stick in die Bibliothek.“
gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat(te), eben weil – siehe Zitat aus der FAZ – eine digitale Kopie eines Lehrbuchs, zumal eine, die eher nur ein reines Scanabbild darstellt, nicht dem entspricht, was einer auf Lernerfolg gerichteten Auseinandersetzung mit solchen Medien entspricht. Erstaunlich ist freilich, dass sich digitale Varianten, die derartige Enhancements bieten, bisher nicht auf dem Buchmarkt durchsetzen konnten. Die Gründe dafür sind vermutlich vielfältig und reichen vom diesbezüglich überschaubaren Angebot seitens der Verlage bis hin zu den Anforderungen an die Hardware, die nicht selten eine simple aber grundsätzliche Nutzungshürde darstellen.
Eine Lösungsvariante könnte man in browserbasierten und eher als E-Learning-Applikationen denn als Lehrbücher zu verstehenden Vermittlungsformen sehen. Annotieren, Hervorheben, Kommentieren, Teilen sind Grundprinzipien zeitgenössischer Webnutzung und für alle dieser Nutzungsformen sind anwendbare Werkzeuge längst entwickelt. Wie entsprechende tragfähige Geschäfts- und Lizenzmodelle aussehen können und wie sich traditionelle Lehrbuchverlage, die mehr denn je Softwareentwicklungspartner brauchen, dabei aufzustellen vermögen, ist dagegen sicher eine noch zu bewältigende Herausforderungen. Entsprechend verwundert es nicht, dass der Printmarkt für Lehrbücher nach wie vor deutlich größer ist als der Digitalmarkt. Sowohl Form wie auch Nutzungsregeln sind sofort einsichtig und weithin bekannt. Und dazu kommt, dass man mit dem gedruckten Lehrbuch ohne Login und unter jeder Lichtquelle sofort in die Interaktion mit dem Lernstoff einsteigen kann. Für die Mehrzal der Lehrbuchnutzer_innen dürfte dies nach wie vor ein maßgebliches Kriterium sein.
(bk / 10.06.2015)
FAZ / geg.: Dem Buchhandel fehlen die Bestseller. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.06.2015, S. 21
Matthias Ulmer: Die Landesbibliothek als Copyshop. In: boersenblatt.net, 02.04.2009