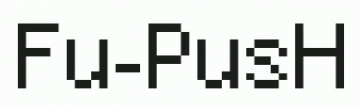Am Montag, den 18. April 2016 stellte die Edition TOPOI des Exzellenzclusters TOPOI (HU und FU Berlin) auf der Kick-Off-Veranstaltung zum „Wissenschaftlichen Publizieren+“ nicht nur eine ergänzende Note zur Berlin Declaration on Open Access in the Sciences and Humanities vor, sondern auch ihre neu entwickelten Publikationswerkzeuge, zum einen das „Digitally Enhanced Book“ (dEbook) und zum anderen das sogenannte „Citable“ als Beschreibungsformat für Forschungsdatenpublikationen.
Bei dem dEbook handelt es sich um ein Werkzeug zur Verknüpfung von publizierten Texten mit Forschungsdaten, bei dem Autorinnen und Autoren ihre Publikationen mit online verfügbaren Zusatzmaterialien wie Datenbanken, Graphiken oder 3D-Modellen vernetzen und präsentieren können. Dabei werden die Referenzobjekte allerdings nicht selbst in die Publikation integriert, sondern lediglich die zu Grunde liegenden Metadaten in einer Textdatei (.dEbook) erfasst und somit für das Sammeln, Senden und Teilen system- und softwareunabhängig bereitgestellt.
Die entsprechende Webapplikation trägt den etwas irreführenden Namen „dEbook-Viewer“, obwohl es sich nicht nur um ein Rezeptions-Tool handelt, sondern auch der Erstellung von Verknüpfungen und Annotationen dient. Auf diese Weise wird nicht nur ein interaktives Lesen und Recherchieren mit den integrierten Wörterbüchern, Lexika sowie Text- und Bildrecherche-Tools ermöglicht, sondern auch die aktive Anreicherung von Publikationen, die im PDF-Format vorliegen, durch Verlinken und Annotieren. Die Publikationen der Edition TOPOI stehen somit, nicht zuletzt da sie konsequent Open Access angeboten werden, als Digitally Enhanced Book zur Verfügung.
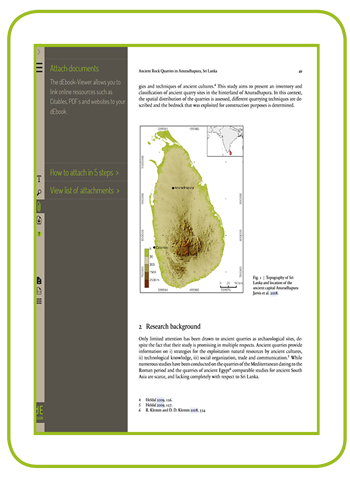
Entsprechend der Forderung des Exzellenzclusters TOPOI, dass Gedächtnis- und Bildungsinstitutionen ihre Digitalisate offen, maschinenlesbar und dauerhaft zitierfähig online zur Verfügung stellen, entwickelte die Edition TOPOI das Citable als ein Format zur Beschreibung von digitalen Forschungsdaten als eigenständige Publikationen. Das Citable integriert technische und beschreibende Metadaten sowie Lizenzinformationen mit dem jeweiligen persistenten Identifikator im JSON-Format, womit eine einfache Nachnutzung bzw. Weiterbearbeitung etwa durch Modifikationen und weitere Anreicherungen ermöglicht werden soll.
Während die ebenfalls im Cluster entwickelten Viewer-Technologien bereits deutlich erkennbare Mehrwerte durch umfangreiche Funktionalitäten bieten, beispielsweise bei der Betrachtung von 3D-Modellen, werden auf der Webseite der Edition TOPOI allerdings nur wenige Details des neuen Beschreibungsformates präsentiert. Es bleiben vor allem Fragen etwa hinsichtlich des Metadatenschemas, der technischen Umsetzung einer Versionierung, der Einbindung in Nachweissysteme sowie der Langzeitarchivierung bzw. -verfügbarkeit offen, so dass man gespannt sein darf auf die weiteren Entwicklungen.

In den Fu-PusH-Dossiers werden die im Projekt erhobenen Forschungsdaten ausgewertet und zusammengefasst. Die Datengrundlage des vorliegenden Dossiers umfasst die 192 Statements, die mit Rechtsgrundlage gefiltert wurden.
Kernaussagen
- Die zentralen Rechtsgebiete für das wissenschaftliche Publizieren sind das Urheberrecht (Publikationen) sowie das Datenschutzrecht (Forschungsdaten).
- Die geltenden urheberrechtlichen Regelungen werden als unzureichend für die Anforderungen einer digitalen Wissenschaft empfunden.
- Es besteht der Wunsch nach einer Stärkung der Nutzungsrechte an Publikationen bzw. Forschungsdaten durch Forschende, wobei die Notwendigkeit eines Interessensausgleiches zwischen allen Beteiligten betont wird.
- Eine offene Wissenschaft im Sinne des Open-Access-Gedankens erfordert die Einbettung in einen verlässlichen Rechtsrahmen.
- Eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke des Urheberrechts wird zwar begrüßt, aber zugleich wird auf die damit einhergehende Privilegierung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hingewiesen.
- Forschende könnten bereits viel gewinnen, wenn sie kompetenter und konsequenter ihre Rechte wahrnehmen und wissenschaftsfreundlichere Autorenverträge aushandeln.
- Infrastruktureinrichtungen wie beispielsweise Bibliotheken sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beim Aushandeln von Autorenverträgen aktiv unterstützen und insbesondere darauf hinweisen, dass die Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte an die Verlage den Interessen der Wissenschaft grundsätzlich entgegen steht.
- Lizenzmodelle wie Creative Commons werden als geeignetes Mittel zur Spezifizierung von Verwertungs- bzw. Nutzungsrechten für Forschende angesehen.
- Die empfohlene Creative-Commons-Lizenz ist für alle Publikationselemente, die dem wissenschaftlichen Anspruch an Nachvollziehbarkeit entsprechen sollen, die CC-BY-Lizenz; dagegen wird die CC-0-Lizenz für Norm- und Metadaten empfohlen.
- Die Veröffentlichung und Nachnutzung von Forschungsdaten ist ein zentrales Thema mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten sowohl hinsichtlich des Urheberrechts als auch des Datenschutzrechts.
- Ein großes Problem stellt die Verfügbarkeit von in Gedächtnisinstitutionen vorgehaltenen Forschungsmaterialien dar, für die Zugang, Digitalisierungsmöglichkeiten und vor allem die Nachnutzungsoptionen oft erheblich durch hausrechtliche Regelungen und institutionelle Urheberechtsansprüche eingeschränkt werden.
- Die Handlungsfelder zeigen sich für Bibliotheken und Infrastrukturdienstleister vor allem in der Kompetenzvermittlung bei Rechtsfragen sowie beim Aufbau von wissenschaftsfreundlichen und zugleich rechtssicheren Publikationsinfrastrukturen.
Rechtliche Aspekte beim wissenschaftlichen Publizieren
Aktuelle Rechtsthemen
In den Fu-PusH-Dossiers werden die im Projekt erhobenen Forschungsdaten ausgewertet und zusammengefasst. Die Datengrundlage des vorliegenden Dossiers umfasst die 41 Statements, die mit sowohl mit Förderinstitutionen als auch mit Empfehlungen gefiltert wurden.
Auswertung
Prinzipiell wird anerkannt, dass den Förderinstitutionen im Bereich des geisteswissenschaftlichen Publizierens eine hohe wissenschaftspolitische Bedeutung zukommt (2594). Dies gilt insbesondere bei Standardisierungsprozessen (2734), bei der Etablierung bzw. Weiterentwicklung von projekt- bzw. institutionsübergreifenden Infrastrukturen (2799) sowie bei der Ausrichtung hin zu einer offenen Wissenschaft.
Die Förderung von Open Access wird sowohl im nationalen (z.B. DFG) als auch im europäischen Kontext (z.B. Horizon2020) als Leitlinie begrüßt (507, 558, 559, 911, 1581, 1984). Zum Teil wird sich auch dafür ausgesprochen, Open Access noch stärker und langfristiger zu fördern (2973, 2974, 3375) oder sogar als Bedingung vorzugeben (2972, 3064). Als wichtige förderpolitische Maßnahmen gelten vor allem die Etablierung von Publikationsfonds sowie die Deckelung von Publikationspauschalen im Zusammenhang mit Article Processing Charges (3255).
Vor allem die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wird als eine Institution wahrgenommen, die sich aktiv um die Förderung einer offenen Wissenschaft bemüht und zugleich darauf bedacht ist, ihre Vorgaben nicht abgekoppelt von den Interessen der jeweiligen Fach-Communities zu treffen (309, 507, 1209). Der von der DFG besonders betonte Aspekt der Nachhaltigkeit beim wissenschaftlichen Publizieren, etwa bei der Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit oder bei der Nachnutzung von Forschungsdaten und -infrastrukturen wird von den Befragten als wichtig und richtig angesehen (353, 2798). Auch die Vorgabe, dass es für jedes geförderte Projekt eine digitale Komponente geben muss, wird für sinnvoll erachtet (2324). Als Desiderat wird dagegen die Unterstützung der zentralen Diskussionen innerhalb einzelner Wissenschaftsbereiche formuliert (310, 311, 312, 2733).
Als eine Herausforderung wird die Zunahme des Publikationsaufkommens empfunden, die zum Teil auch durch bestehende Anreizsysteme mit verursacht wird, weshalb durchaus erwogen wird, diesem Phänomen förderpolitisch entgegen zu wirken (478).
Kritisch wird die Fokussierung der Forschungsevaluation auf quantitative Indikatoren eingeschätzt, da diese als ungeeignet gelten sowohl für die Grundlagenforschung als auch für viele genuin geisteswissenschaftliche Forschungsansätze (479, 2862).
Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen spielen förderpolitisch eine große Rolle etwa bei der Etablierung offener Publikationsformen (3065) oder der Nutzung des Zweitveröffentlichungsrechtes (890). Allerdings sollte durch förderpolitische Maßnahmen weder die Verlagsvielfalt (511) noch die Publikationsfreiheit eingeschränkt werden (3211, 3282).
Bei der finanziellen Projektförderung wird die Möglichkeit einer flexibleren Umwidmung der Mittel als sinnvoll erachtet (509). Prinzipiell wird sich dafür ausgesprochen, dass die Publikationskosten als Teil der Programmpauschale aufgefasst werden sollten (566, 1576).
Beim wissenschaftlichen Publizieren wird auch die Förderung von innovativen und experimentellen Ansätzen wie beispielsweise im Bereich des Enhanced Publishing als wichtig angesehen (1464, 1465). In diesem Zusammenhang wird gefordert, dass alternative Kommunikations- und Publikationsformen (z.B. Blogs) sowohl bei der Kreditierung (2736) als auch bei den Publikationskosten stärker berücksichtigt werden (826).
Darüber hinaus sollten Förderinstitutionen auch Richtlinien vorgeben für den Umgang mit Forschungsdaten und entsprechende Ressourcen bei der Projektbewilligung bereitstellen (823). Im Hinblick auf die Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit wird betont, dass auch die Dokumentation der Software bzw. digitalen Werkzeuge als Richtlinie verankert werden sollte. Zudem erscheint es gerade für die Geisteswissenschaften unerlässlich, über den üblichen Zeitraum von 10 Jahren für die Bewahrung digitaler Publikationen hinaus zu denken (2329).
(Berlin, 11.02.2016)
In den Fu-PusH-Dossiers werden die im Projekt erhobenen Forschungsdaten ausgewertet und zusammengefasst. Für die Auswertung werden jeweils aus Sicht des Projektes relevante thematische Relationen, ermittelt anhand von Kookkurrenzen von Tags, betrachtet. Die Datengrundlage des vorliegenden Dossiers umfasst die 47 Statements, die sowohl mit Bibliotheken als auch mit Forschungsdaten gefiltert wurden.
Kernaussagen
- Bibliotheken sind Forschungsdatenlieferanten vieler Geisteswissenschaften, da für diese Disziplinen häufig die in Bibliotheken vorhandenen Bestände als Forschungsgrundlage genutzt werden. Dazu zählen besonders digitalisierte Quellenmaterialien, die einem engeren Verständnis geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten entsprechen.
- Digitale Forschungsdaten wirken vor allem im Bereich des Zugangs, führen aber, u.a. im Umfeld der Digital Humanities, zu methodologischen Veränderungen geisteswissenschaftlicher Forschung.
- Die Rolle der Bibliotheken für das Forschungsdatenmanagement wird unterschiedlich bewertet. Bislang liegt die Zuständigkeit für das, was unter Forschungsdatenverwaltung verstanden wird, eher bei IT-Abteilungen.
- Es wird gefordert, dass Bibliotheken einschlägige Expertise aufbauen und zumindest Beratungsdienstleistungen zu Forschungsdaten und zur Forschungsdatenpublikation entwickeln.
- Bibliotheken werden durchgängig mit dem Aspekt der digitalen Langzeitarchivierung assoziiert. Entsprechende Lösungen werden von dieser Seite erwartet.
- Forschungsdaten spielen sowohl für die Forschung wie auch für das Forschungscontrolling (Nachvollziehbarkeit) eine zentrale Rolle.
- Herausforderungen nicht zuletzt für Langzeitverfügbarkeit von Forschungsdaten liegen in der sich potentiell entwickelnden Datenmenge, der Datenheterogenität sowie den rechtlichen Hürden.
- Die Herausforderungen des Forschungsdatenmanagements erfordern kooperative Lösungen zwischen Bibliotheken, technischen Anbietern und den Fachwissenschaften.
Auswertung
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Science findet sich ein Artikel von Jorge L. Contreras und Jerome H. Reichman zu Strukturen und Kosten des Teilens von Forschungsdaten. Damit schließen sie an eines der Trendthemen unter anderem auch in der Bibliothekswissenschaft und Informationsinfrastrukturforschung an. Je mehr man sich mit den Themen Forschungsdaten und Forschungsdatenpublikation befasst, desto deutlicher treten freilich die Desiderata hervor. Allem voran geht die Frage nach der Möglichkeit entsprechender allgemeinverbindlicher Minimalstandards. Klar ist, dass der Trend zur Openness, der sich in Formeln wie „Open Science“ und „Open Scholarship“ kristallisiert, die gegenwärtige Wissenschaftspraxis maßgeblich prägt. Forschungsdaten sollen neben den Forschungspublikationen – also den als Paper, Aufsatz, Blogpost, Monografie o.ä. veröffentlichten Forschungsnarrativen – möglichst ohne Einschränkung zur Einsicht und Nachnutzung verfügbar gemacht werden.
Die Motivation findet sich einerseits im Erhöhung der Forschungstransparenz ergo Nachvollziehbarkeit der in den Forschungspublikationen dargelegten Analysen und Deutungen. Andererseits greift das durchaus ökonomisch motivierte Argument, dass man den einmal erhobenen Datensatz auch für andere Analysen heranziehen und beforschen kann. Das nennt man Nachnutzung.
Ein nächste Stufe der Forschungsdatenintegration wird schließlich erreicht, wenn man die einzelnen Datensätze vor der Veröffentlichung so aufbereitet, dass sie maschinenlesbar und automatisiert mit anderen Datensätzen verknüpfbar werden können. Derartige Netzwerke strukturierter Daten sind eine Herzensangelegenheit der Digital Humanites und ein bibliotheks- und netzwissenschaftes Perspektivthema, dem massives Potenzial zugeschrieben wird. Big Data und Semantic Web sind die rahmenden Termini.
An sich klingt es einfach und lässt sich prima an die Commons-Überlegungen der Netzkultur anschließen, wenn Jorge Contreras und Jerome Reichmann schreiben:
„Perhaps the most straightforward path to legal interoperability is simply to contribute data to the public domain and waive all future rights to control it. This approach has been advocated by more than 250 organizations that have endorsed the 2010 Panton Principles for open data in science.“
Die wissenschaftliche Realität setzt diesem Wunsch nach Gemeinfreiheit freilich ein ganze Bandbreite von Hürden entgegen, die nun zum Teil auf den persönlichen Verwertungs- und Kontrollanspruch der jeweiligen Datenerheber zugeführt werden können. Gerade persönlichkeitsrechtliche Aspekte und das hohe Gut des Datenschutzes bremsen die Möglichkeiten der Forschungsdatenpublikation vor allem dort, wo es sich um empirische Sozialforschung handelt. Auch wir konnten im Rahmen des Fu-PusH-Projektes entsprechend qualifizierte Erfahrungen sammeln.
Eine weitere Herausforderung bei der offenen Datenpublikation liegt schließlich in der wissenschaftstheoretischen Fragestellung, wie sehr der konkrete Forschungskontext – also die Forschungsfrage – das zulässige Analyse- und Deutungsspektrum für einen Datensatz definiert. Und schließlich unterläuft die künstlerisch orientierte Remixkultur des Netzes, auf die auch einige der Creative-Commons-Lizenzen vorrangig abzielen, den wissenschaftlichen Anspruch an Datenintegrität. Das kreative „Verändern“ von Forschungsdatenkontexten ist mit der guten wissenschaftlichen Praxis kaum vereinbar. Jorge Contreras und Jerome Reichmann benennen Creative Commons dennoch als Option:
„Alternatively, researchers who wish to receive attribution credit for their contributions, but are otherwise willing to relinquish control over them, have released data under standardized Creative Commons licenses that have been widely used for other online content, including open-source code software, music, and photographs. „
Sie merken zugleich an, dass diese Ansätze unzureichend und problematisch sein können. Dies bestätigt auch unser während des Projektes gewonnener Eindruck. Das Thema liegt sehr im Trend, wird aber derzeit an vielen Stellen jedenfalls in den Geisteswissenschaften eher allgemein als auf konkret realisierbare Lösungen hin diskutiert. Das könnte seine Ursache auch darin haben, dass aktuell Akteure fehlen, die Aktivitäten im Bereich der digitalen Forschungsdatenpublikationen für diese Disziplinen übergreifend und vor allem fachkulturell weithin anerkannt koordinieren.
Quelle:
Contreras, Jorge L.; Reichmann, Jerome H.: Sharing by design: Data and decentralized commons. In: Science 11 December 2015: Vol. 350 no. 6266 pp. 1312-1314 DOI: 10.1126/science.aaa7485
In der Tageszeitung Der Standard erschien unlängst ein weiterer Beitrag über Open Access, diesmal aus österreichischer Sicht und erwartungsgemäß eher allgemein gehalten. Wer sich mit der Debatte etwas auskennt, findet daher sicher wenige neue Einsichten und stattdessen mehr Erinnerungen an heißere Phasen der Debatte, denn sogar sowohl Roland Reuß mit seiner Warnung vor dem Zwang zu Open Access wie auch Uwe Jochum mit seiner These, dass digitale Daten nur mit unkalkulierbaren, in jedem Fall äußerst hohen Kosten langzeiterhalten werden können, finden sich in dem Artikel wieder.
Aus Sicht von Fu-PusH sind zwei andere Aspekte notierenswert. So bestätigt Bernhard Haslhofer unsere Erfahrung, dass es beim Open Access keine alle Fachkulturen integrierende Generallösung geben kann und auch überhaupt Formen digital vermittelteter Wissenschaftskommunikation in der einen Disziplin der Normal- und in einer anderen ein Sonderfall sind:
Über die Repositories-Mailingliste der JISC wurde heute ein von eben dieser JISC im Rahmen des Research Data Spring gefördertes Projekt namens Clipper mit dem Aufruf zum Feedback gestreut. Mit dem auf den ersten Blick, nämlich dem des Demos, erfreulich überschaubar gehaltenen und auf HTML5 setzenden Werkzeugs soll es möglich sein, Bewegtbild, Tonaufnahmen und also so genannte „time-based media“ zu markieren und zu annotieren sowie die Annotationen, mit einem URI versehen, zu teilen. In der Beschreibung liest sich das folgendermaßen:
Users will be able to specify what parts of a video or audio recording to select and share in the form of ‘virtual clips’, by indicating a source, start and end time. In addition, they can associate descriptive textual annotations with each clip that are used as a basis for exploratory search across clip collections. Clips from the same, or different, video and audio files, can be combined to create a clip playlist – which we call ‘cliplists’ – that enable researchers to structure and view the data according to their coding themes. Rather than just embedding an online video or linking to one, Clipper opens up new possibilities for research data service development using time-based media.
Ein Democlip auf Youtube visualisiert das entsprechend:
Eine Anmerkung von Ben Kaden (@bkaden)
Im Deutschlandfunk konnte man unlängst einen Dialog hören, der alle, die sich permanent im Bereich digitaler Wissenschaftskommunikation und z.B. auch den Digital Humanities bewegen, noch einmal daran erinnern könnte, dass zwischen dem, was für sie selbstverständlich scheint und dem, was wissenschaftsgesellschaftlicher Mainstream ist, eine deutliche Lücke besteht. Benedikt Schulz unterhielt sich mit dem Wissenschaftssoziologen Peter Weingart über Open Access und führte zum Ende des knappen Interviews noch einmal eine Grundfrage an:
„Vielleicht mal mit Blick in die Zukunft: Wird denn digitale Publikation das wissenschaftliche Arbeiten an sich verändern?“
Für uns ist das ja eher ein Blick in die jüngere Vergangenheit, denn die Veränderung ist längst da und an vielen Stellen führte sie zu neuen Quasi-Standards. Peter Weingart betont dies ja auch in seiner Antwort:
von Ben Kaden (@bkaden)
Die Bewertung von Twitter als Medium der wissenschaftlichen Kommunikation schwankt, so legen es auch die Fu-PusH-Interviews nah, oft zwischen dem Nutzen als Streu- und Netzwerkmedium und Ablehnung bzw. Unverständnis. Selbst vielen, die Twitter wohlwollend gegenüber stehen, erscheint der Gedanke, mittels Microblogging auch so etwas wie einen argumentativen Austausch durchzuführen, eher befremdlich. Das mag daran liegen, dass in den Geisteswissenschaften ein Argument in 140 Zeichen kaum eine Tradition hat. Und sicher sind komplexe Argumentationsführungen schwer abbildbar. Der Tweet-Stream von @NEINQuarterly zeigt immerhin in einem hohen Elaborationsgrad, wie sich wenigstens in englischer Sprache punktgenau und meist nah am Aphorismus Wahrnehmungen und Alltagskommentare in diesem Zeichenumfang verdichten lassen (ein aktuelles Beispiel).
Dass aber auch ein richtiger Dialog unter Nutzung von Twitter möglich ist, zeigt das unten als Screenshot zitierte Beispiel aus der vergangenen Woche. Ausgangspunkt war ein Artikel in der Tageszeitung The Guardian. In diesem argumentierte der Start-Up-Unternehmer Ijad Madisch (Porträt bei Wired), dass die Zeit des PDF als Publikationsformat in der Wissenschaft endlich vorbei sein sollte. Seine Stimme hat diesbezüglich Gewicht, denn sein Start-Up ist das soziale Netzwerk für Wissenschaftler ResearchGate (Wikipedia). Es liegt auf der Hand, dass ein derart kommerzieller Anbieter die in seinem Netzwerk entstehenden Daten als Basis eines Geschäftsmodells nutzen möchte, das wiederum, so es denn angenommen wird, auf die wissenschaftliche Kommunikation selbst zurückwirkt. Madischs Anliegen ist nun, das Format des PDFs durch ein anderes zu ersetzen:“one that’s open, easy to work with and social.“
Er benennt drei Argumente, die gegen das PDF-Format sprechen: Erstens liest es sich schwierig, weil man zu den Zitationen und dann wieder zur Textstelle zurückscrollen muss. Beheben ließe sich das durch eine einfache Optimierung der Bildschirmdarstellung. Zweitens führt nicht zuletzt die Geschlossenheit des Formats dazu, dass die Kommunikation per PDF ein Ein-Kanal-Geschehen bleibt. Feedback zu der so publizierten Forschung erscheint an einem anderen Ort (in einem anderen PDF) und ist so nicht an das Ursprungsdokument angekoppelt. Und drittens ist es zumindest teilweise dem Format des PDFs geschuldet, wenn wissenschaftliche Publikationen so wenig gelesen werden. Was daran liegt, dass die Einzeldatei ohne Kontextualisierung im Netz steht, wobei hier natürlich eine automatisierbare und maschinenlesbare Kontextualisierung gemeint sein muss. Denn alle möglichen Metadaten vom Titel der Zeitschrift über Keywords bis hin zur Korrespondenzadresse der Autoren erzeugen semantisch schon Kontext. Diesen nachzuvollziehen ist sogar technisch möglich, aber eben etwas aufwendig. So ist Forschungskommunikation im PDF-Format für Madisch potentiell verloren: „The results are lost like a package without an addressee.“
Neu ist das alles nicht. So argumenierten zum Beispiel 2006 Michael Seringhaus und Mark Gerstein in einem Artikel namens The Death of the Scientific Paper (in: The Scientist, Vol. 20, Iss.9, S.25) für die Überwindung des wissenschaftlichen Fachaufsatzes wie wir ihn (auch neun Jahre später und ziemlich unverändert) kennen und notierten:
von Ben Kaden (@bkaden)
An der Universität Leipzig wird ab diesem Frühjahr ein peer reviewed Open-Acess-Journal mit dem Namen Digital Classics Online erscheinen. Das meldete gestern die Universität Pressemitteilung: „Digital Classics Online“: Leipziger Historiker geben neue elektronische Zeitschrift heraus.
Inwieweit Aspekte des Enhanced Publishing dort einfließen werden, ist noch nicht erkennbar. Von der Ausrichtung und der Verortung im Digital-Humanities-Bereich würde das aber ausgezeichnet passen. In der Pressemitteilung betont die Mitherausgeberin Charlotte Schubert zudem:
„[D]ie technischen Möglichkeiten in der Wiedergabe von Multi-Media-Inhalten sind neu und waren bisher so nicht realisierbar.“