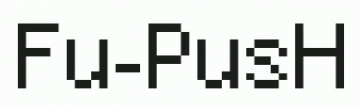von Ben Kaden (@bkaden)
Die Bewertung von Twitter als Medium der wissenschaftlichen Kommunikation schwankt, so legen es auch die Fu-PusH-Interviews nah, oft zwischen dem Nutzen als Streu- und Netzwerkmedium und Ablehnung bzw. Unverständnis. Selbst vielen, die Twitter wohlwollend gegenüber stehen, erscheint der Gedanke, mittels Microblogging auch so etwas wie einen argumentativen Austausch durchzuführen, eher befremdlich. Das mag daran liegen, dass in den Geisteswissenschaften ein Argument in 140 Zeichen kaum eine Tradition hat. Und sicher sind komplexe Argumentationsführungen schwer abbildbar. Der Tweet-Stream von @NEINQuarterly zeigt immerhin in einem hohen Elaborationsgrad, wie sich wenigstens in englischer Sprache punktgenau und meist nah am Aphorismus Wahrnehmungen und Alltagskommentare in diesem Zeichenumfang verdichten lassen (ein aktuelles Beispiel).
Dass aber auch ein richtiger Dialog unter Nutzung von Twitter möglich ist, zeigt das unten als Screenshot zitierte Beispiel aus der vergangenen Woche. Ausgangspunkt war ein Artikel in der Tageszeitung The Guardian. In diesem argumentierte der Start-Up-Unternehmer Ijad Madisch (Porträt bei Wired), dass die Zeit des PDF als Publikationsformat in der Wissenschaft endlich vorbei sein sollte. Seine Stimme hat diesbezüglich Gewicht, denn sein Start-Up ist das soziale Netzwerk für Wissenschaftler ResearchGate (Wikipedia). Es liegt auf der Hand, dass ein derart kommerzieller Anbieter die in seinem Netzwerk entstehenden Daten als Basis eines Geschäftsmodells nutzen möchte, das wiederum, so es denn angenommen wird, auf die wissenschaftliche Kommunikation selbst zurückwirkt. Madischs Anliegen ist nun, das Format des PDFs durch ein anderes zu ersetzen:“one that’s open, easy to work with and social.“
Er benennt drei Argumente, die gegen das PDF-Format sprechen: Erstens liest es sich schwierig, weil man zu den Zitationen und dann wieder zur Textstelle zurückscrollen muss. Beheben ließe sich das durch eine einfache Optimierung der Bildschirmdarstellung. Zweitens führt nicht zuletzt die Geschlossenheit des Formats dazu, dass die Kommunikation per PDF ein Ein-Kanal-Geschehen bleibt. Feedback zu der so publizierten Forschung erscheint an einem anderen Ort (in einem anderen PDF) und ist so nicht an das Ursprungsdokument angekoppelt. Und drittens ist es zumindest teilweise dem Format des PDFs geschuldet, wenn wissenschaftliche Publikationen so wenig gelesen werden. Was daran liegt, dass die Einzeldatei ohne Kontextualisierung im Netz steht, wobei hier natürlich eine automatisierbare und maschinenlesbare Kontextualisierung gemeint sein muss. Denn alle möglichen Metadaten vom Titel der Zeitschrift über Keywords bis hin zur Korrespondenzadresse der Autoren erzeugen semantisch schon Kontext. Diesen nachzuvollziehen ist sogar technisch möglich, aber eben etwas aufwendig. So ist Forschungskommunikation im PDF-Format für Madisch potentiell verloren: „The results are lost like a package without an addressee.“
Neu ist das alles nicht. So argumenierten zum Beispiel 2006 Michael Seringhaus und Mark Gerstein in einem Artikel namens The Death of the Scientific Paper (in: The Scientist, Vol. 20, Iss.9, S.25) für die Überwindung des wissenschaftlichen Fachaufsatzes wie wir ihn (auch neun Jahre später und ziemlich unverändert) kennen und notierten: