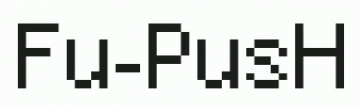von Ben Kaden (@bkaden)
Die Bewertung von Twitter als Medium der wissenschaftlichen Kommunikation schwankt, so legen es auch die Fu-PusH-Interviews nah, oft zwischen dem Nutzen als Streu- und Netzwerkmedium und Ablehnung bzw. Unverständnis. Selbst vielen, die Twitter wohlwollend gegenüber stehen, erscheint der Gedanke, mittels Microblogging auch so etwas wie einen argumentativen Austausch durchzuführen, eher befremdlich. Das mag daran liegen, dass in den Geisteswissenschaften ein Argument in 140 Zeichen kaum eine Tradition hat. Und sicher sind komplexe Argumentationsführungen schwer abbildbar. Der Tweet-Stream von @NEINQuarterly zeigt immerhin in einem hohen Elaborationsgrad, wie sich wenigstens in englischer Sprache punktgenau und meist nah am Aphorismus Wahrnehmungen und Alltagskommentare in diesem Zeichenumfang verdichten lassen (ein aktuelles Beispiel).
Dass aber auch ein richtiger Dialog unter Nutzung von Twitter möglich ist, zeigt das unten als Screenshot zitierte Beispiel aus der vergangenen Woche. Ausgangspunkt war ein Artikel in der Tageszeitung The Guardian. In diesem argumentierte der Start-Up-Unternehmer Ijad Madisch (Porträt bei Wired), dass die Zeit des PDF als Publikationsformat in der Wissenschaft endlich vorbei sein sollte. Seine Stimme hat diesbezüglich Gewicht, denn sein Start-Up ist das soziale Netzwerk für Wissenschaftler ResearchGate (Wikipedia). Es liegt auf der Hand, dass ein derart kommerzieller Anbieter die in seinem Netzwerk entstehenden Daten als Basis eines Geschäftsmodells nutzen möchte, das wiederum, so es denn angenommen wird, auf die wissenschaftliche Kommunikation selbst zurückwirkt. Madischs Anliegen ist nun, das Format des PDFs durch ein anderes zu ersetzen:“one that’s open, easy to work with and social.“
Er benennt drei Argumente, die gegen das PDF-Format sprechen: Erstens liest es sich schwierig, weil man zu den Zitationen und dann wieder zur Textstelle zurückscrollen muss. Beheben ließe sich das durch eine einfache Optimierung der Bildschirmdarstellung. Zweitens führt nicht zuletzt die Geschlossenheit des Formats dazu, dass die Kommunikation per PDF ein Ein-Kanal-Geschehen bleibt. Feedback zu der so publizierten Forschung erscheint an einem anderen Ort (in einem anderen PDF) und ist so nicht an das Ursprungsdokument angekoppelt. Und drittens ist es zumindest teilweise dem Format des PDFs geschuldet, wenn wissenschaftliche Publikationen so wenig gelesen werden. Was daran liegt, dass die Einzeldatei ohne Kontextualisierung im Netz steht, wobei hier natürlich eine automatisierbare und maschinenlesbare Kontextualisierung gemeint sein muss. Denn alle möglichen Metadaten vom Titel der Zeitschrift über Keywords bis hin zur Korrespondenzadresse der Autoren erzeugen semantisch schon Kontext. Diesen nachzuvollziehen ist sogar technisch möglich, aber eben etwas aufwendig. So ist Forschungskommunikation im PDF-Format für Madisch potentiell verloren: „The results are lost like a package without an addressee.“
Neu ist das alles nicht. So argumenierten zum Beispiel 2006 Michael Seringhaus und Mark Gerstein in einem Artikel namens The Death of the Scientific Paper (in: The Scientist, Vol. 20, Iss.9, S.25) für die Überwindung des wissenschaftlichen Fachaufsatzes wie wir ihn (auch neun Jahre später und ziemlich unverändert) kennen und notierten:
„[I]t has become obvious that preserving data in its native digital format – with search, annotation, and update capabilities – is desirable. Databases are already the primary form of information storage and access for genomics and protein structure research.“
Der Forschungsdatenboom (inklusive der Idee einer mandatierten Forschungsdatenpublikation) und die Notwendigkeit einer interaktiven Auseinandersetzung wurden da schon fast wie allgemeingültige Einsichten verhandelt.
Gleiches galt natürlich für Kontextualisierungen mit all dem, was wir unter Enhancements von Publikationen diskutieren:
„For instance, a data set might link not only to its companion article, but also to earlier versions of the data, news coverage, reviews, and related talks given by the authors. Community annotation and discussion would add another dimension to peer review, and interested parties of all pedigrees could access information at a level suitable to their needs.“
Die Autoren benannten auch schon ein Problem, was möglicherweise die Überlebensfähigkeit des PDF-Formates maßgeblich grundiert: Wissenschaftliche Kreditierung findet traditionell auf Basis der in die Form eines weitgehend statischen Aufsatzes (oder in den Geisteswissenschaften: eines Buches) eingepassten Forschung statt und wird bislang nur in dieser Form übergreifend anerkannt. Die klassische Publikation ist das, was im Zweifelsfall bei der Forschungsevaluation zählt. Das will bislang kein Wissenschaftler aufs Spiel setzen bzw. hören wir vermutlich von den Wissenschaftlern, die sich dem entziehen, einfach nichts (mehr) innerhalb des Wissenschaftssystems. (Weitere Gründe, warum das PDF in den Geisteswissenschaften eine so zentrale spielt, habe ich in diesem Blogposting erörtert.)
ResearchGate könnte versuchen, das mit seinem so genannten RG Score zu unterlaufen. Das gelänge freilich nur, wenn ResearchGate auch den überwiegenden Teil des wissenschaftlichen Kommunikationsgeschehens in seinen Datenbanken relationieren kann. Was uns zu dem kleinen, unten dokumentierten Twitter-Trialog zwischen Hendrik Buschmeier (@hbuschme), Christian Pietsch (@ChPietsch) und schließlich Charles Knight (@Charlesknight) führt. Denn genau gegen die Gefahr einer solchen denkbaren und über ein Alternativformat durchgesetzten Kontrolle der Forschungskommunikation durch ResearchGate richtet sich deren Kritik.
Madisch selbst erwähnt (a) den PubReader™ des National Center for Biotechnology Information (NCBI), der von Kent Anderson vor allem als ein Werkzeug zur Markenstärkung von Pubmed Central angesehen wurde, die auf Kosten der Verlager geht. Und (b) einen Article of the Future genannten Ansatz von Elsevier. Beide sind strukturgemäß als Versuche zu sehen, sich im Feld der wissenschaftlichen Kommunikation mit einer Zukunftstechnologie möglichst zentral zu positionieren. Dass ResearchGate selbst mit dem RG Format nachzieht, ergänzt die Redaktion des Guardian in einem Nachsatz freundlicherweise für ihre Leser.
Die auf Twitter Diskutierenden suchen nun nach anderen Alternativen und Hendrik Buschmeier erwähnt zudem eine weitere Stärke des PDF-Formats: es lässt sich abspeichern und offline lesen. Gerade seine Geschlossenheit eröffnet dem Leser also zusätzliche Optionen. Christian Pietsch setzt dagegen auf EPUB3, also einen offenen Standard, der ähnliches zu leisten in Aussicht stellt, was Pubmed Central, Elsevier und ResearchGate für ihre Lösungen versprechen. Charles Knight argumentiert schließlich von der Formatfrage selbst weg zu einem Kern der digitalen Ökonomie: die Nutzung von Angeboten wie ResearchGate beruht wie auch zum Beispiel bei Facebook auf dem Tausch der Nutzung einer Plattform gegen das Einspeisen von Daten in die dahinterstehenden Datenbanken, wobei diese Daten den Wert des Unternehmens erhöhen.
Auf die Frage, ob bzw. weshalb eine solche Konzentration für die Wissenschaft ein Problem wäre, kann man Seringhaus und Gerstein mit ihrer 2006er Kritik am Vorgehen des heutigen PubReader™-Anbieters, des National Center for Biotechnology Information (NCBI) antworten lassen:
„The major difference is that the NCBI approach is monolithic: an attempt to amass and house all scientific communication in one place. This is neither realistic nor desirable. We must recognize the plurality of voices contributing to science worldwide. The driving force behind data integration should not be a single American entity; instead, it should be a collaborative effort driven by journals: decentralized information, central access.“
Womit man im Prinzip ein Argument gegen jedes proprietäre Format hätte. Das trifft selbstverständlich auch das PDF-Format. Diesem, bzw. Adobe, muss man im vorliegenden Fall aber zugutehalten, dass der begrenzte und geschlossene Ansatz zwar zu einer sperrigen Speicher- und Darstellungsform führt. Darüberhinaus aber belässt es die wissenschaftliche Kommunikation in ihren traditionellen und vielfältigen Bahnen ohne übergeordneten Kontrollanspruch. Und es soll ja nicht wenige Wissenschaftler geben, die damit in ihrem Alltag gar nicht so unglücklich sind.