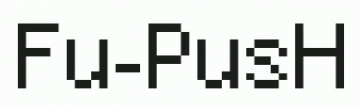Ein Gastbeitrag von Anne Baillot
Nach der Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities 2003 schien sich bis zum 10jährigen Jubiläum derselben in der Hauptstadt in Sachen Open Access noch nicht sehr viel bewegt zu haben. Die Tatsache, dass die Implementierung der im Jahr 2003 unterzeichneten Ziele einige Institutionen nach wie vor vor große Herausforderungen stellte, regte den Einstein-Zirkel Digital Humanities 2015 dazu an, in Form von Interviews mit VertreterInnen einschlägiger Forschungseinrichtungen aus Berlin und Brandenburg den Status quo in der geisteswissenschaftlichen Forschung zu erheben, Best Practices zu erfassen und Zukunftsperspektiven darzustellen. Doch noch ehe die Interviewergebnisse ausgewertet und veröffentlicht werden konnten, hat die Thematik eine neue Dimension gewonnen. Open Access gehört inzwischen zur Digitalen Agenda der Hauptstadt; die Max-Planck-Gesellschaft hat eine Gold-OA-Offensive unter dem Banner „OA2020“ hervorgetrommelt und in einem offiziellen Amtsakt wird eine neue Bekräftigung der Berliner Erklärung von einigen Schlüsselakteuren veröffentlicht und beworben. Zentral scheint nicht nur die Frage zu sein, welche Formen von Wissenschaft Open Access ermöglichen, sondern auch, wenn nicht vorrangig, welche Art von Wissenschaftspolitik.
Das Open-Access-Kapitel des vom Einstein-Zirkel vorbereiteten Sammelbandes, der im Juni 2016 unter dem Titel Berliner Beiträge zu den Digital Humanities erscheinen wird, widmet sich dem Thema Open Access in den Geisteswissenschaften. Es enthält neben Aufsätzen (bereits als Preprint: „Open Humanities?“ von Michael Kleineberg) die Ergebnisse und das Wortlaut von 2015 an einschlägigen Einrichtungen durchgeführten Interviews zum Thema Open Access. Ausgangspunkt der Reflexion war die einmalige Situation der deutschen Hauptstadt, in der Open Access geisteswissenschaftlich Forschende an den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ebenso betrifft wie GLAM-Einrichtungen (Galerien, Bibliotheken, Archive, Museen). Es ist diese einmalige Berlin-Brandenburgische Landschaft, die in den Mittelpunkt der Open Access-Interviews gerückt wurde.
Die Interviews gehen auf die breit gefächerten, auf die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtung zugeschnittenen, in den Jahren seit der Berlin Declaration jeweils entwickelten Portfolios ein. Der pragmatische Teil der Auseinandersetzung mit dem Open-Access-Prinzip im Bereich der geisteswissenschaftlichen Forschung wird damit deutlich: Wer Lust hat, Open Access zu publizieren, findet in Berlin und Umgebung in seiner Einrichtung einen erprobten Weg, dies zu tun. Doch die Hauptfrage bleibt: Wer hat Lust, Open Access zu publizieren, und wer kann es sich leisten? An dieser Stelle gilt es zu unterstreichen, dass trotz der ebenfalls vielfältigen Beratungsangebote der jeweiligen Einrichtungen die Kluft zwischen Reputation und Leserschaft bei den WissenschaftlerInnen nach wie vor nicht überbrückt zu sein scheint: Papier ist für die Reputation, Open Access um gelesen zu werden, wobei Ersteres die akademischen Karrieren dominiert.
Aber es geht bei Weitem nicht nur um akademische Karrieren. Ein Blick nach Frankreich, wo die Verankerung von Text und Data Mining im neu entstehenden „Digitalen Gesetz“ von WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen im Gespräch mit einander ausgearbeitet und debattiert wird (vgl. die Wiedergabe der Vorschläge und Gegenvorschläge zum neuen Gesetz unter dem Hashtag #PJLNumerique und auf der Webseite des Französischen Senats zu diesem Gesetz), zeigt, dass die politische, wirtschaftliche, aber auch beispielsweise gesundheitsökonomische Brisanz von Open Access, gekoppelt mit juristischen Fragen wie dem Schutz der Privatsphäre, unsere Zukunft entscheidend prägen wird. Und deswegen sollte es nicht nur darum gehen, sich zu fragen, ob NachwuchswissenschaftlerInnen ihre Preprints online stellen sollten (die Antwort darauf ist eindeutig: Ja!), und auch nicht darum, ob Bücher abgeschafft werden sollen (die Antwort darauf ist eindeutig: Nein!), sondern, welche Zivilgesellschaft dadurch entsteht, dass sie zu dieser Art von Wissen Zugang hat: Wie bringen wir unseren Kindern bei, das Internet sinnvoll zu nutzen? Welche juristischen Weichen können wir heute stellen? Wie können wir dafür sorgen, dass das, was wir heute Open Access veröffentlichen, morgen noch zugänglich sein wird? Diese Fragen sind die der Digital Humanities.
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Science findet sich ein Artikel von Jorge L. Contreras und Jerome H. Reichman zu Strukturen und Kosten des Teilens von Forschungsdaten. Damit schließen sie an eines der Trendthemen unter anderem auch in der Bibliothekswissenschaft und Informationsinfrastrukturforschung an. Je mehr man sich mit den Themen Forschungsdaten und Forschungsdatenpublikation befasst, desto deutlicher treten freilich die Desiderata hervor. Allem voran geht die Frage nach der Möglichkeit entsprechender allgemeinverbindlicher Minimalstandards. Klar ist, dass der Trend zur Openness, der sich in Formeln wie „Open Science“ und „Open Scholarship“ kristallisiert, die gegenwärtige Wissenschaftspraxis maßgeblich prägt. Forschungsdaten sollen neben den Forschungspublikationen – also den als Paper, Aufsatz, Blogpost, Monografie o.ä. veröffentlichten Forschungsnarrativen – möglichst ohne Einschränkung zur Einsicht und Nachnutzung verfügbar gemacht werden.
Die Motivation findet sich einerseits im Erhöhung der Forschungstransparenz ergo Nachvollziehbarkeit der in den Forschungspublikationen dargelegten Analysen und Deutungen. Andererseits greift das durchaus ökonomisch motivierte Argument, dass man den einmal erhobenen Datensatz auch für andere Analysen heranziehen und beforschen kann. Das nennt man Nachnutzung.
Ein nächste Stufe der Forschungsdatenintegration wird schließlich erreicht, wenn man die einzelnen Datensätze vor der Veröffentlichung so aufbereitet, dass sie maschinenlesbar und automatisiert mit anderen Datensätzen verknüpfbar werden können. Derartige Netzwerke strukturierter Daten sind eine Herzensangelegenheit der Digital Humanites und ein bibliotheks- und netzwissenschaftes Perspektivthema, dem massives Potenzial zugeschrieben wird. Big Data und Semantic Web sind die rahmenden Termini.
An sich klingt es einfach und lässt sich prima an die Commons-Überlegungen der Netzkultur anschließen, wenn Jorge Contreras und Jerome Reichmann schreiben:
„Perhaps the most straightforward path to legal interoperability is simply to contribute data to the public domain and waive all future rights to control it. This approach has been advocated by more than 250 organizations that have endorsed the 2010 Panton Principles for open data in science.“
Die wissenschaftliche Realität setzt diesem Wunsch nach Gemeinfreiheit freilich ein ganze Bandbreite von Hürden entgegen, die nun zum Teil auf den persönlichen Verwertungs- und Kontrollanspruch der jeweiligen Datenerheber zugeführt werden können. Gerade persönlichkeitsrechtliche Aspekte und das hohe Gut des Datenschutzes bremsen die Möglichkeiten der Forschungsdatenpublikation vor allem dort, wo es sich um empirische Sozialforschung handelt. Auch wir konnten im Rahmen des Fu-PusH-Projektes entsprechend qualifizierte Erfahrungen sammeln.
Eine weitere Herausforderung bei der offenen Datenpublikation liegt schließlich in der wissenschaftstheoretischen Fragestellung, wie sehr der konkrete Forschungskontext – also die Forschungsfrage – das zulässige Analyse- und Deutungsspektrum für einen Datensatz definiert. Und schließlich unterläuft die künstlerisch orientierte Remixkultur des Netzes, auf die auch einige der Creative-Commons-Lizenzen vorrangig abzielen, den wissenschaftlichen Anspruch an Datenintegrität. Das kreative „Verändern“ von Forschungsdatenkontexten ist mit der guten wissenschaftlichen Praxis kaum vereinbar. Jorge Contreras und Jerome Reichmann benennen Creative Commons dennoch als Option:
„Alternatively, researchers who wish to receive attribution credit for their contributions, but are otherwise willing to relinquish control over them, have released data under standardized Creative Commons licenses that have been widely used for other online content, including open-source code software, music, and photographs. „
Sie merken zugleich an, dass diese Ansätze unzureichend und problematisch sein können. Dies bestätigt auch unser während des Projektes gewonnener Eindruck. Das Thema liegt sehr im Trend, wird aber derzeit an vielen Stellen jedenfalls in den Geisteswissenschaften eher allgemein als auf konkret realisierbare Lösungen hin diskutiert. Das könnte seine Ursache auch darin haben, dass aktuell Akteure fehlen, die Aktivitäten im Bereich der digitalen Forschungsdatenpublikationen für diese Disziplinen übergreifend und vor allem fachkulturell weithin anerkannt koordinieren.
Quelle:
Contreras, Jorge L.; Reichmann, Jerome H.: Sharing by design: Data and decentralized commons. In: Science 11 December 2015: Vol. 350 no. 6266 pp. 1312-1314 DOI: 10.1126/science.aaa7485
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht in ihrer heutigen Ausgabe auf der Seite zum Thema Forschung und Lehre ein Interview mit dem Archivwissenschaftler Eckhart Henning über die „prekäre Lage der historischen Archivwissenschaften“. Aus der Perspektive von Fu-PusH ist das Thema aus mehreren Gründen interessant. So gibt es durchaus die Position, dass sich das nach wie vor im Fokus aller Zukunftsdiskussionen zu den Geisteswissenschaften unweigerlich einfindende Feld der Digital Humanities zumindest in der Tradition der Hilfswissenschaften verortet. (vgl. Wettlaufer, 2014) Von den Auxilia Historica zu lernen, kann hier also durchaus sinnvoll sein. Weiterhin stellt sich die Frage der Auswahl, Erschließung und Vermittlung potentiell für die Geisteswissenschaften relevanter Objekte in den etablierten Kulturspeichern ganz generell. Hier könnte man neben der Archivwissenschaft durchaus auch die Bibliothekswissenschaft in der Rolle einer solchen Hilfsdisziplin sehen und diskutieren – nicht unbedingt zum Gewinn der Fächer. (vgl. u.a. Stäcker, 2005, S.36) Schließlich stellt sich damit verknüpft und immergrün die Frage, wie man mit digitalen Materialien hinsichtlich einer angestrebten Langzeitverfügbarkeit verfährt.
Zu allen drei Aspekten finden sich im Interview einige interessante Aussagen. So legt Eckart Henning dar, dass die historischen Hilfswissenschaften mit ihrem Analyseansatz „den Naturwissenschaften oft näher als den Geisteswissenschaften“ sind. Das ergibt sich vermutlich bereits deshalb, weil ihre Funktion einen bestimmten Analysebedarf adressiert, der offenbar nicht ohne weiteres direkt in geisteswissenschaftliche Forschungsprozesse integrierbar ist. Die Hilfswissenschaften komplementieren die dort eingesetzten Methodologien hinsichtlich eines bestimmten Bedarfs. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass …weiterlesen »
„The demographic of print readers is thought to be an aging, behind-the-times cohort of the sort of people who still get paper copies of newspapers.“
Mit dieser mehr oder weniger selbstinduzierten Einschätzung erläutert Michael Chibnik als Herausgeber der Zeitschrift American Anthropologist (AA) in der Early-View-Fassung des Editorials für die nächste und offenbar letzte gedruckte Ausgabe, warum sich die Zeitschrift demnächst als reine Digitalausgabe versteht. Er rettet die leicht pejorativ anmutende Rhetorik ein wenig dadurch, dass er sich per Fußnote selbst zum Angehörigen dieser verschwindenden Epoche zählt. Interessant ist in der Nebensache, wie auch hier die Digitalisierung von Journalismus (=newspapers) und dem wissenschaftlichen Publizieren im selben Kontext, nämlich dem des Trends zur digitalen Rezeption, erscheint. In der Hauptsache lässt sich im Goodbye to Print betitelten Editorial aber auch erkennen, wie eine Triebkraft hinter dem Schritt eine ökonomische ist:
„The association will be able to save the significant amounts of money that have been spent printing and distributing paper copies of AA.“
Die andere Kraft ist die des tatsächlichen Nutzungsverhaltens. Offenbar hat beispielsweise an Chibniks Universität für eine ganze Weile niemand gemerkt, dass die Printausgabe längst abbestellt worden war. Man liest, wie ich übrigens auch, heute mehrheitlich wissenschaftliche Fachaufsätze über den Onlinezugang der Bibliothek und wenn ein Text interessant erscheint, dann druckt man ihn eben am Schreibtisch extra aus.
Eine aus Sicht unseres Projektes interessante Überlegung ist die Ablösung der Idee der Einzelausgabe (issue), die im Digitalen formal ein Anachronismus ist, und die Ersetzung durch content streams. Letztere sind in Grundzügen dank der Early-View-Angebote auf vielen Publikationsplattformen bereits realisiert. American Anthropologist wird die ausgabenbasierte Erscheinungsweise dennoch, wenn auch mit antizipiert schwindender Bedeutung, vorerst beibehalten:
„The primarily digital nature of AA in the future can only accelerate the diminishing importance of “issues.” Readers will no longer be able to browse through a paper copy of the journal that arrives in the mail, looking at whatever catches their eye. Instead, they will likely receive electronic alerts when an issue comes out accompanied by a list of contents. „
Die Folgefrage, inwieweit nach dem angekündigten Abschied vom Print und von der Erscheinungsform in Issues das Format der Zeitschrift selbst zeitstabil bleiben kann, wird vorerst ausgespart. Diese Überlegung käme möglicherweise auch zu zeitig. Denn bisher geht es allein darum, die digitale Präsenz der Zeitschrift allgemein zu verstärken. Michael Chibnik betont die forcierte Umstellung auf die Online-Variante damit, dass beim American Anthropologist bisher wenig in dieser Richtung geschieht. Der Schritt setzt dahingehend ein Zeichen und zwar explizit für die ihm nachfolgenden Herausgeber.
Das man laut Selbsteinschätzung bei den Ausgaben hinter den digitalen Möglichkeiten zurückbleibt, liegt nicht unbedingt an der Redaktion selbst, die durchaus Möglichkeit zum erweiterten Publizieren anbietet:
„Right now AA does relatively little online. Authors of research articles have the option of providing online-only, unedited “supplementary information.” This can include material such as interview transcripts, large tables, complex figures, and videos. Despite my urging, few authors have taken advantage of the opportunity to present material in this way.“
Die enhanced-article-Optionen von Blackwell-Wiley werden für die Rezipienten angeboten, wobei ebenfalls nicht klar ist, wie intensiv diese Funktionalitäten genutzt werden.
Etwas wird Michael Chibnik allerdings vermutlich vermissen:
„One minor casualty of the switch to digital may be AA’s cover. … The small cover image on the journal website cannot be enlarged. It would probably not be difficult to provide an enlargeable cover on the website in the future. Even so, the impact of an electronic cover seems considerably less than that of a print cover.“
Das wäre dann so eine Art Schallplatteneffekt. Aber glücklicherweise, auch für den Editor-in-Chief selbst, geht man bei der Neuorientierung auf e-only am Ende doch nicht aufs Ganze. Wer mag, kann sich die Zeitschrift gegen Aufpreis nach wie vor als Printausgabe zusenden lassen. Michael Chibnik wird dies tun. Ob der American Anthropologist dann mit oder ohne Cover im Postfach landet, ist aktuell nicht bekannt.
(bk, Berlin, 02.11.2015)
Quelle:
Michael Chibnik (2015): Goodbye to Print. In: American Anthropologist. Early View (Article first published online: 28 September 2015) DOI:
In den Fu-PusH-Interviews fiel das Stichwort „Big Data“ vergleichsweise selten. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass es im Umfeld der Geisteswissenschaften keine Rolle spielt, denn unser Erkenntnisinteresse war doch eher auf das Publizieren und nicht so sehr auf die Forschungspraxis gerichtet. Entsprechend finden sich Überlegungen zur Transformation geisteswissenschaftlicher Forschung durch datenzentrierte Verfahren eher an anderer Stelle. Heute beispielsweise im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung für das Urs Hafner von der infoclio.ch-Tagung 2015 mit dem Motto Daten und Geschichtswissenschaften berichtet. Eine wichtige und sehr grundsätzliche Einsicht wollen wir aus diesem Bericht gern festhalten, da sie wiederum drei für das Publizieren sehr zentralen Aspekt berührt:
„Für den Wissenschaftshistoriker Bruno Strasser von der Universität Genf sind grosse Datenmengen an sich nichts Neues. In der «data-driven science» jedoch, welche die Wissenschaftswelt erobere – die Geisteswissenschaften bilden ein Residuum –, kämen nun zwei Traditionen der Naturwissenschaften zusammen, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden seien: die sammelnde und vergleichende Naturgeschichte sowie die experimentelle Naturforschung. «Big Data» werfe neue Fragen auf: nach der Autorschaft, die nun zugleich individuell und kollektiv sei, nach dem Eigentum an Daten, nach deren Gebrauch, nach deren «epistemischem Status». – Solche Fragen sollten in einem einschlägigen nationalen Forschungsprogramm auf keinen Fall fehlen.“
Prinzipiell zeigt sich eine gewisse Übereinstimmung des die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägenden Wandels zur Big Science und dem Aufblühen der Empirie als immer mehr eingefordertes und daher elaboriertes Verifikationsinstrument für die Theoriebildung (oft: Little Science). Insofern ist Big Data in der Wissenschaft selbst ein eher älteres Thema, eng verbunden mit der Gerätewissenschaft (bzw. auch Großforschung) und den dort notwendigen Spezialisierungen. Wer welchen Teil der Autorschaft bei dieser gruppenbasierten Erkenntnisfindung übernimmt, ist freilich auch dort oft umstritten. Für die Geisteswissenschaftler, die sich vergleichsweise deutlich stärker als Werkschöpfer sehen, wo Naturwissenschaftler mit dem gelungenen Nachweis glücklich sind, sind diese Phänomene weitgehend neu. Es sind möglicherweise die Digital Humanities, die nun das Kollektivelement und die Arbeitsteilung zwischen Datenerhebern, den Entwicklern von Algorithmen und den Wissenschaftlern, die Fragestellungen formulieren bzw. Schlüsse ziehen und vielleicht noch einigen anderen Akteuren in die Wissenschaftspraxis hineinbringen. Selbstverständlich verändert sich eine Wissenschaft, die sich viel stärker auf die Empirie von Daten und den Erkenntniszugang per Algorithmus stützt, in ihren epistemischen Fundamenten. Oder – was nach wie vor bei den Digital Humanities offen ist – fungiert losgelöst von den klassischen Wissenschaften als eigenes Forschungsfeld. In jedem Fall muss sie spezifisch fragen, nach welchen Bedingungen die Forschungsgrundlage (Daten) und die Erhebungs- und Präsentationswerkzeuge (Algorithmen, Visualisierungen, etc.) entstehen und wie sie als Dispositive für die Erkenntnisfindung wirken. Dies gilt insbesondere auch für die Metaebene der Forschungsförderung, die mit ihrer Agenda selbst ein Dispositiv setzt, das bestimmte Forschungsformen begünstigt und andere ausschließt.
(bk / 20.10.2015)
Urs Hafner: Gemachte Tatsachen. «Big Data» und die Geschichtswissenschaft. In: Neue Zürcher Zeitung / nzz.ch. 20.10.2015
von Ben Kaden (@bkaden)
Ende September gab es ein Ereignis, auf das wir aus der Fu-PusH-Perspektive unbedingt noch hinweisen müssen. Mit der Open Library of Humanities ging ein geisteswissenschaftliches Metajournal online, das versucht, den digitalen Möglichkeiten und den Ansprüchen der Zielgruppen gleichermaßen gerecht zu werden. Der Wille, etwas Neues zu schaffen, zeigt sich bereits im Veröffentlichungszyklus. Der Wille, ganz oben auf der Reputationsskala nicht etwa zu landen sondern gleich zu starten zeigt sich in der sehr selbstbewussten Selbstbeschreibung:
„The Open Library of Humanities journal publishes internationally-leading, rigorous and peer-reviewed scholarship across the humanities disciplines: from classics, theology and philosophy, to modern languages and literatures, film and media studies, anthropology, political theory and sociology.“
Die geplante wöchentliche Erscheinungsweise folgt dem Modell der großen naturwissenschaftlichen Titel und strukturell wie namenstechnisch sicher nicht zufällig der Public Library of Science (PLOS).
Das Modell des Meta- bzw. Megajournals impliziert, dass es sich nicht um eine einzelne Zeitschrift sondern um eine Plattform handelt, auf der unterschiedliche Zeitschriften (oder thematische Kollektionen) erscheinen können. Das alles geschieht Open Access und ohne Article Processing Charges, die für viele GeisteswissenschaftlerInnen ohnehin eine kaum zu nehmende Hürde darstellen. Die Ursache liegt besonders in Großbritannien und den USA auch darin, dass den Geisteswissenschaften große Teile der Förderung weggestrichen werden (in Japan versucht man offenbar, sie völlig aufzulösen). Die Kosten bei der OLH werden stattdessen von einem Bibliothekskonsortium getragen, dass um den Wert dieser Fächer genauso weiß, wie darum, dass die geisteswissenschaftliche Wissenschaftskommunikation dringend eine neue und gegenwartstaugliche Fassung benötigt. Damit erhält übrigens en passant die in den Fu-PusH-Interviews oft und intensiv diskutierte Frage, inwieweit Bibliotheken selbst als publizierende Akteure aktiv werden sollten, eine Antwort: Sie finanzieren kollaborativ eine übergeordnete Plattform, die außerhalb des kommerziellen Verlagswesens stehend Open Access als Non-Profit-Variante ermöglicht:
„Indeed, the model that underpins the platform is novel for humanities journals: many libraries all paying relatively small sums into a central fund that we then use, across our journal base, to cover the labour costs of publication once material has passed peer review. Libraries that participate are given a governance stake in the admission of new journals. While this model is strange in many ways (as libraries are not really buying a subscription since the material is open access), it works out to be extremely cost effective for participants. In our first year, across the platform, we look set to publish around 150 articles. For our bigger supporting institutions, this is a cost of merely $6.50 per article. For our smallest partners, it comes to $3.33. This economy of charitable, not-for-profit publishing works well at 100 institutions. It should work even better with the 350 libraries that we are aiming to recruit to our subsidy scheme in the first 3 years after launch.“
Hier besteht also auch für das deutsche Bibliothekswesen noch genügend Spielraum, sich zu positionieren.
Mit der Finanzierung wirkt offensichtlich auch eine bibliothekarische Kompetenz in das Projekt hinein. Die OLH übernimmt nicht nur vorgegebene Lösungen, sondern möchte selbst als Pilot neue Publikationsvarianten sowohl technisch wie auch organisatorisch anregen, was uns aus Sicht eines zugegeben sehr viel winzigeren Forschungsprojektes mit nicht ganz unähnlicher Ausrichtung selbstverständlich hochsympathisch ist. Die Bandbreite der Aufzählung mit den Entwicklungsfeldern deckt die Bedarfe, die uns die befragten GeisteswissenschaftlerInnen sowie VertreterInnen aus dem Bereich der Wissenschaftsinfrastruktur nannten, mehr als ab:
„including multi-lingual publishing, inter-lingual translation facilities, annotation and pedagogical integration, and post-publication peer review/discussion.“
Mehrsprachiges Publizieren ist in den deutschen Geisteswissenschaften nämlich eher ein Nebenthema und auch die pädagogische Komponente (= Lehre) ist nicht übermäßig präsent. Aus bibliothekswissenschaftlicher Sicht ist zudem ein weiterer Anspruch des Angebots hochinteressant:
„[t]o improve further the indexing and discoverability of our platform through cross-site search and integration with a range of aggregation services that feed into library platforms“
Aus der Berliner Sicht wünschten wir uns natürlich, dass lieber früher als später auch die deutsche Bibliothekswissenschaft den Anschluss an solche Projekte findet.
Dass das Unterfangen ein Wagnis ist, wissen auch Martin Eve und Caroline Edwards, die Direktoren der OLH. In ihrem Einstiegseditorial betonen sie, dass, obschon es eigentlich kaum einen guten Zeitpunkt zur Gründung eines Journals gibt, das Jahr 2015 ein besonders wenig günstiger Moment ist. Man könnte da sicher auch Gegenargumente finden, aber an sich stimmt die Zeitdiagnose, aus der diese Einsicht entspringt: das Digitale bietet unvergleichliche technische Möglichkeiten und führt zu schwer absehbaren sozialen Erwartungen. Parallel verlieren geisteswissenschaftliche Zeitschriften massiv an Bedeutung, was unter anderem daran liegt, dass die Bibliotheken aufgrund steigender Subskriptionskosten (in der Regel für nicht-geisteswissenschaftliche Materialien) gezwungen sind, Titel abzustellen. Andererseits, so die Autoren, ist Open Access eine riesige Chance und zwar dahingehend, dass die Geisteswissenschaften durch die neuen Disseminationsmöglichkeiten befähigt werden, die Grenzen ihrer Fachcommunities zu überschreiten und eine deutlich größere Öffentlichkeit zu erreichen.
Dafür, dass das gelingt, nahm man sich Zeit und entwickelte in zweieinhalb Jahren, also mit bibliothekarischer Gründlichkeit, ein Konzept, dessen Umsetzung auch zuversichtlich den Aspekt des Wachstums („scalability“) enthält. Ob diese Planung aufgeht, ist freilich noch nicht abzusehen und hängt maßgeblich von der Akzeptanz in den jeweiligen Fachgemeinschaften ab. Als Versuch wirkt die OLH aber außerordentlich vielversprechend und ist ein schönes zweites Modelle neben der bisher in der Anmutung doch noch deutlich eleganteren Blog-Plattform Hypotheses um geisteswissenschaftliche Fachkommunikation mit den Bedingungen und Möglichkeiten des Digitalen angemessen und vielleicht auch ein wenig mutig zu interpretieren. Ob das perspektivisch eher mit WordPress oder Open Journal Systems oder beidem oder einer neuen technischen Grundlage geschieht, wird sich dann auch noch zeigen.
Martin Eve, Opening the Open Library of Humanities. Editorial. In: Open Library of Humanities, Vol.1, Iss. 1. DOI: 10.16995/olh.46
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht heute (Mittwoch, 02.09.2015) auf ihrer Seite Forschung und Lehre (N4) gleich zwei Beiträge, die unmittelbar für die Domäne, in welcher Fu-PusH forscht, relevant sind. Einerseits befasst sich Magnus Klaue mit dem Phänomen der Universitätsverlage und den Unterschieden zwischen den deutschen und den angloamerikanischen Modellen. Den Ausgangspunkt des Artikels bietet die Bedeutung solcher Verlage vor allem für die Publikation von Qualifikationsarbeiten, die es in den Geisteswissenschaften zeitnah und möglichst einschlägig mit Renommé umzusetzen gilt:
„Erscheint eine Dissertation später als drei Jahre nach Abschluss des Promotionsverfahrens, kann es Probleme mit dem Erhalt des akademischen Titels geben. Erscheint die Arbeit in einer wenig renommierten Reihe, mindert das die Chance von Rezensionen. Die meisten geisteswissenschaftlichen Dissertationen werden, obwohl digitale Publikationsmöglichkeiten bestehen, noch immer in traditionellen Wissenschaftsverlagen herausgebracht.“
In Deutschland ist das vergleichsweise teuer und mühsam. Die Hausverlage von Universitäten in den USA oder Großbritannien haben neben den offenbar einfacheren Publikationsmöglichkeiten gegenüber ihren deutschen Gegenstücken oft auch den Vorteil, dass sie als Verlag eine Reputation besitzen, die den deutschen Universitätsverlagen in der Regel fehlt. Zudem schlagen sie die Brücke zwischen der wissenschaftlichen und der außerakademischen Öffentlichkeit. Ein Fachbuch gelangt so auch auf den Sachbuchmarkt und ist, sofern das Lektorat gute Arbeit leistet, auch für ein allgemeines Publikum interessant.
In Deutschland, so merkt Magnus Klaue an, werden die beiden Öffentlichkeiten häufig streng getrennt gesehen. Tatsächlich bestätigen auch die Fu-PusH-Interviews, dass hierzulande wissenschaftliche Publikationen für den allgemeinen Publikumsmarkt eine große Ausnahme darstellen.
Zusammenfassend stellt der Autor fest: …weiterlesen »
In der Tageszeitung Der Standard erschien unlängst ein weiterer Beitrag über Open Access, diesmal aus österreichischer Sicht und erwartungsgemäß eher allgemein gehalten. Wer sich mit der Debatte etwas auskennt, findet daher sicher wenige neue Einsichten und stattdessen mehr Erinnerungen an heißere Phasen der Debatte, denn sogar sowohl Roland Reuß mit seiner Warnung vor dem Zwang zu Open Access wie auch Uwe Jochum mit seiner These, dass digitale Daten nur mit unkalkulierbaren, in jedem Fall äußerst hohen Kosten langzeiterhalten werden können, finden sich in dem Artikel wieder.
Aus Sicht von Fu-PusH sind zwei andere Aspekte notierenswert. So bestätigt Bernhard Haslhofer unsere Erfahrung, dass es beim Open Access keine alle Fachkulturen integrierende Generallösung geben kann und auch überhaupt Formen digital vermittelteter Wissenschaftskommunikation in der einen Disziplin der Normal- und in einer anderen ein Sonderfall sind:
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden).
Eine zentrale Frage für alle, die sich mit konkreten Lösungen für kulturelle Überlieferungen befassen und damit insbesondere „Gedächtnisinstitutionen wie Archiv und Bibliothek“ (Wolfgang Ernst), lautet: Wie sammeln und archivieren wir digitale Inhalte möglichst lange und möglichst verfügbar? Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliografie (ZfBB) widmet sich nun dieser Herausforderung unter der Überschrift „Webarchivierung in Bibliotheken“.
In seinem Beitrag Memorisierung des »Web« – Von der emphatischen Archivierung zur Zwischenarchivierung der Gegenwart analysiert der Medientheoretiker Wolfgang Ernst vor allem aus der Perspektive von Zeitlichkeit und Flüchtigkeit:
„Das Vertrauen auf die Strahlkraft des Wissens in Archiven und Bibliotheken, das seit Zeiten der Schriftträger und des Buchdrucks das abendländische Bewusstsein prägt, unterliegt einer doppelten Transformation, die radikaler nicht sein kann. Einmal wandeln sich litterae in binär kodierte Datenworte (Bits); zudem transformiert ihre Substanz von dauerhafter Fixierung (Tinte und Druckschwärze) in flüchtige Ladungen und Impulse – von der der Inschrift zum Datenstrom.“
Und eigentlich geht es auch um das Konzept von Geschichtlichkeit, das für unsere Kultur und vor allem auch die Geisteswissenschaften prägend war und ist und das nun vielleicht gefährdet ist. Denn:
„Das vertraute Konzept von historischer Zeit bedeutet Computern nichts.“
Was freilich implizierte, dass Computer so etwas wie Bedeutung kennen könnten. Solange sie allerdings im Erbe der Kommunikationstheorie nach Claude Shannon operieren, ist das nicht zu erwarten. Sinnvoller wäre folglich, zu fragen, ob wir das Konzept der historischen Zeit im Digitalen verankern wollen? Bejahen wir das, muss man entsprechende informatische Strategien angehen. Das ist selbstredend eine Kulturaufgabe ersten Ranges. Gedächtnisinstitutionen allein sind, wie aus dem Text Ernsts immer wieder hervorgeht, bereits damit vollausgelastet, die Ansprüche der digitalen Gegenwart anzunehmen, die ihrer Tradition doch erheblich entgegenstrebt. …weiterlesen »
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
Auf der Seite Forschung und Lehre der Frankfurter Allgemeinen Zeitung setzt sich heute (Mittwoch, 08.04.2015) der Historiker Martin Schulze Wessel sehr ausführlich mit der Umorientierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Bereich der wissenschaftlichen Literaturversorgung von Sondersammelgebieten (SSG), bei denen jeweils eine Bibliothek schwerpunktmäßig für ein Wissenschaftsfeld sämtliche verfügbare Fachliteratur zur erwerben anstrebt, in Fachinformationsdienste (FID), die die Fachinformationsversorgung in den Disziplinen flexibler organisieren soll:
„War es das Kernanliegen des alten Systems, durch einen umfassenden Bestandsaufbau nach einheitlichen Kriterien auf möglichst alle Anfragen aus der Wissenschaft reagieren zu können, so kehrt das neue System die Rollen um: Die Wissenschaft selbst soll künftig ihre Erwartungen und aktuellen Bedürfnisse artikulieren; den Bibliotheken wird der enge Austausch „mit bedeutenden Forschungsverbünden im jeweiligen Fachgebiet“ nahegelegt.“