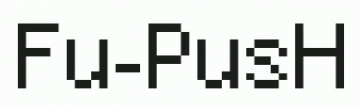Ausgerechnet heute also kürt der Neologismen-Sammeldienst Wordspy den Ausdruck „vanity metric“ zum Wort des Tages. Darunter versteht man:
„A measurement or score that is used to impress other people, but is not a true indicator of quality or success.“
Wer sich ein wenig mit der metrischen Dimension von Wissenschafts- und Social-Impact-Evaluationen befasst, sieht vermutlich sofort die Relevanz eines solchen Konzeptes für unser digital-statistisches Zeitalter. Inwieweit die unten stehende Grafik in diese Kategorie fällt, lassen wir jetzt mal offen. Wir haben jedenfalls die diesjährigen Open-Access-Tage 2015 in Zürich am Montag und Dienstag dieser Woche (07. und 08. 09.2015) intensiv bei Twitter über das Hashtag #oat15 hier in unserem Berliner Bibliotheksbüro mitverfolgt, was zwar nicht so gut ist, wie selbst dabeizusein, was aber immerhin ermöglicht, den thematischen Schwerpunkten der Diskussionen sowie der Grundstimmung der Tagung nachzuspüren. Auch das ist ein Vorteil digitaler Wissenschaftskommunikation: Kennt man das Hashtag einer Veranstaltung, kann man sich nebenbei an jede Konferenz ein wenig andocken, nebenbei der eigentlichen Arbeit nachgehen und dennoch im Diskursraum der jeweiligen Keynotes, Sessions und Workshops ein wenig echoloten.
Damit unsere Twitter-Verfolgung nicht ganz folgenlos bleibt, haben wir eine Grafik mit den Top-40-Accounts, die wir aus dem Tweetaufkommen herausmessen konnten, erstellt. Als besondere Aktivposten stellen sich danach der ScienceOpen-Mitbegründer Alexander Grossmann (@SciPubLab), der Biologe Donat Agosti (@myrmoteras) und der Bertelsmann-Medienexperte Joachim Höper (@Joachim_Hoeper) heraus. Insgesamt lässt sich festhalten, dass bei den Twitterern Personen mit einem Hintergrund im Infrastruktur- und Bibliotheks- oder Publikationsbereich überwiegen. Wir haben nicht alle Accounts verifiziert, können aber doch vermutlich auch so behaupten, dass der Anteil der Fachwissenschaftler und insbesondere von Wissenschaftlern mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund eher überschaubar ist, was freilich auch mit der TeilnehmerInnen-Liste korreliert. Die Open-Access-Tage waren und sind eine Veranstaltung vor allem für Experten aus dem dezidierten Open-Access- und Infrastruktur(entwicklungs)feld und aus der Distanz ist auch gar nicht ersichtlich, inwieweit ein Schritt weiter in die Fachwissenschaften hier möglich oder angestrebt ist. Dass unser eigener Twitter-Strom (@fupush) ganz gut platziert ist, war dagegen nicht beabsichtigt (Stichwort vanity metric), sondern ergab sich ganz natürlich bei diesem Themenfeld. Denn natürlich ist ein Projekt, das sich mit der Zukunft des Publizierens in den Geisteswissenschaften befasst, eindeutig die richtige Zielgruppe für die gegenwärtigen Debatten um Open Access.
Grafik: Martin Walk, Fu-PusH, 11.09.2015, Nachnutzung sehr gern unter den Bedingungen der CC BY 4.0-Lizenz
von Ben Kaden (@bkaden)
Die Bewertung von Twitter als Medium der wissenschaftlichen Kommunikation schwankt, so legen es auch die Fu-PusH-Interviews nah, oft zwischen dem Nutzen als Streu- und Netzwerkmedium und Ablehnung bzw. Unverständnis. Selbst vielen, die Twitter wohlwollend gegenüber stehen, erscheint der Gedanke, mittels Microblogging auch so etwas wie einen argumentativen Austausch durchzuführen, eher befremdlich. Das mag daran liegen, dass in den Geisteswissenschaften ein Argument in 140 Zeichen kaum eine Tradition hat. Und sicher sind komplexe Argumentationsführungen schwer abbildbar. Der Tweet-Stream von @NEINQuarterly zeigt immerhin in einem hohen Elaborationsgrad, wie sich wenigstens in englischer Sprache punktgenau und meist nah am Aphorismus Wahrnehmungen und Alltagskommentare in diesem Zeichenumfang verdichten lassen (ein aktuelles Beispiel).
Dass aber auch ein richtiger Dialog unter Nutzung von Twitter möglich ist, zeigt das unten als Screenshot zitierte Beispiel aus der vergangenen Woche. Ausgangspunkt war ein Artikel in der Tageszeitung The Guardian. In diesem argumentierte der Start-Up-Unternehmer Ijad Madisch (Porträt bei Wired), dass die Zeit des PDF als Publikationsformat in der Wissenschaft endlich vorbei sein sollte. Seine Stimme hat diesbezüglich Gewicht, denn sein Start-Up ist das soziale Netzwerk für Wissenschaftler ResearchGate (Wikipedia). Es liegt auf der Hand, dass ein derart kommerzieller Anbieter die in seinem Netzwerk entstehenden Daten als Basis eines Geschäftsmodells nutzen möchte, das wiederum, so es denn angenommen wird, auf die wissenschaftliche Kommunikation selbst zurückwirkt. Madischs Anliegen ist nun, das Format des PDFs durch ein anderes zu ersetzen:“one that’s open, easy to work with and social.“
Er benennt drei Argumente, die gegen das PDF-Format sprechen: Erstens liest es sich schwierig, weil man zu den Zitationen und dann wieder zur Textstelle zurückscrollen muss. Beheben ließe sich das durch eine einfache Optimierung der Bildschirmdarstellung. Zweitens führt nicht zuletzt die Geschlossenheit des Formats dazu, dass die Kommunikation per PDF ein Ein-Kanal-Geschehen bleibt. Feedback zu der so publizierten Forschung erscheint an einem anderen Ort (in einem anderen PDF) und ist so nicht an das Ursprungsdokument angekoppelt. Und drittens ist es zumindest teilweise dem Format des PDFs geschuldet, wenn wissenschaftliche Publikationen so wenig gelesen werden. Was daran liegt, dass die Einzeldatei ohne Kontextualisierung im Netz steht, wobei hier natürlich eine automatisierbare und maschinenlesbare Kontextualisierung gemeint sein muss. Denn alle möglichen Metadaten vom Titel der Zeitschrift über Keywords bis hin zur Korrespondenzadresse der Autoren erzeugen semantisch schon Kontext. Diesen nachzuvollziehen ist sogar technisch möglich, aber eben etwas aufwendig. So ist Forschungskommunikation im PDF-Format für Madisch potentiell verloren: „The results are lost like a package without an addressee.“
Neu ist das alles nicht. So argumenierten zum Beispiel 2006 Michael Seringhaus und Mark Gerstein in einem Artikel namens The Death of the Scientific Paper (in: The Scientist, Vol. 20, Iss.9, S.25) für die Überwindung des wissenschaftlichen Fachaufsatzes wie wir ihn (auch neun Jahre später und ziemlich unverändert) kennen und notierten:
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
Dass ein großer Teil in digitalen sozialen Netzwerken textuell gefasster Inhalte eher als verschriftlichte Oralität zu bewerten ist, ist kein neue These. Vermutlich handelt es sich genauer um eine Hybridform zwischen dem Mündlichen und dem Geschriebenen. Wohin es sich mehr neigt, ist vielleicht eine Frage der Form, sicher aber eine der Intentionalität. Fraglos trifft zu, was die Bezeichnung „Social Media“ eindeutig macht: Diese Medienformen sind unmittelbarer als formalisierte Publikationsformen auf eine direkte soziale Interaktion, also eine sichtbare Kenntnisnahme und Reaktion, ausgerichtet. Sie mit formaleren Publikationsvarianten gleichzusetzen geht fehl. Schwierig ist jedoch ihre rechtliche Bewertung.
In diesem Zusammenhang tauchte die Frage nach dem Status solcher Kommunikationen im Anschluss an zwei Tweets und als Vorläufer zu einem Blogessay von Xiao Mina (Digital Culture is Like Oral Culture Written Down. In: medium.com, 11.01.2015) im Weblog des Juristen James Grimmelmann wieder auf.
In The Laboratorium (2d ser.) erläutert er: