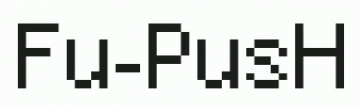Ein Gastbeitrag von Anne Baillot
Nach der Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities 2003 schien sich bis zum 10jährigen Jubiläum derselben in der Hauptstadt in Sachen Open Access noch nicht sehr viel bewegt zu haben. Die Tatsache, dass die Implementierung der im Jahr 2003 unterzeichneten Ziele einige Institutionen nach wie vor vor große Herausforderungen stellte, regte den Einstein-Zirkel Digital Humanities 2015 dazu an, in Form von Interviews mit VertreterInnen einschlägiger Forschungseinrichtungen aus Berlin und Brandenburg den Status quo in der geisteswissenschaftlichen Forschung zu erheben, Best Practices zu erfassen und Zukunftsperspektiven darzustellen. Doch noch ehe die Interviewergebnisse ausgewertet und veröffentlicht werden konnten, hat die Thematik eine neue Dimension gewonnen. Open Access gehört inzwischen zur Digitalen Agenda der Hauptstadt; die Max-Planck-Gesellschaft hat eine Gold-OA-Offensive unter dem Banner „OA2020“ hervorgetrommelt und in einem offiziellen Amtsakt wird eine neue Bekräftigung der Berliner Erklärung von einigen Schlüsselakteuren veröffentlicht und beworben. Zentral scheint nicht nur die Frage zu sein, welche Formen von Wissenschaft Open Access ermöglichen, sondern auch, wenn nicht vorrangig, welche Art von Wissenschaftspolitik.
Das Open-Access-Kapitel des vom Einstein-Zirkel vorbereiteten Sammelbandes, der im Juni 2016 unter dem Titel Berliner Beiträge zu den Digital Humanities erscheinen wird, widmet sich dem Thema Open Access in den Geisteswissenschaften. Es enthält neben Aufsätzen (bereits als Preprint: „Open Humanities?“ von Michael Kleineberg) die Ergebnisse und das Wortlaut von 2015 an einschlägigen Einrichtungen durchgeführten Interviews zum Thema Open Access. Ausgangspunkt der Reflexion war die einmalige Situation der deutschen Hauptstadt, in der Open Access geisteswissenschaftlich Forschende an den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ebenso betrifft wie GLAM-Einrichtungen (Galerien, Bibliotheken, Archive, Museen). Es ist diese einmalige Berlin-Brandenburgische Landschaft, die in den Mittelpunkt der Open Access-Interviews gerückt wurde.
Die Interviews gehen auf die breit gefächerten, auf die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtung zugeschnittenen, in den Jahren seit der Berlin Declaration jeweils entwickelten Portfolios ein. Der pragmatische Teil der Auseinandersetzung mit dem Open-Access-Prinzip im Bereich der geisteswissenschaftlichen Forschung wird damit deutlich: Wer Lust hat, Open Access zu publizieren, findet in Berlin und Umgebung in seiner Einrichtung einen erprobten Weg, dies zu tun. Doch die Hauptfrage bleibt: Wer hat Lust, Open Access zu publizieren, und wer kann es sich leisten? An dieser Stelle gilt es zu unterstreichen, dass trotz der ebenfalls vielfältigen Beratungsangebote der jeweiligen Einrichtungen die Kluft zwischen Reputation und Leserschaft bei den WissenschaftlerInnen nach wie vor nicht überbrückt zu sein scheint: Papier ist für die Reputation, Open Access um gelesen zu werden, wobei Ersteres die akademischen Karrieren dominiert.
Aber es geht bei Weitem nicht nur um akademische Karrieren. Ein Blick nach Frankreich, wo die Verankerung von Text und Data Mining im neu entstehenden „Digitalen Gesetz“ von WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen im Gespräch mit einander ausgearbeitet und debattiert wird (vgl. die Wiedergabe der Vorschläge und Gegenvorschläge zum neuen Gesetz unter dem Hashtag #PJLNumerique und auf der Webseite des Französischen Senats zu diesem Gesetz), zeigt, dass die politische, wirtschaftliche, aber auch beispielsweise gesundheitsökonomische Brisanz von Open Access, gekoppelt mit juristischen Fragen wie dem Schutz der Privatsphäre, unsere Zukunft entscheidend prägen wird. Und deswegen sollte es nicht nur darum gehen, sich zu fragen, ob NachwuchswissenschaftlerInnen ihre Preprints online stellen sollten (die Antwort darauf ist eindeutig: Ja!), und auch nicht darum, ob Bücher abgeschafft werden sollen (die Antwort darauf ist eindeutig: Nein!), sondern, welche Zivilgesellschaft dadurch entsteht, dass sie zu dieser Art von Wissen Zugang hat: Wie bringen wir unseren Kindern bei, das Internet sinnvoll zu nutzen? Welche juristischen Weichen können wir heute stellen? Wie können wir dafür sorgen, dass das, was wir heute Open Access veröffentlichen, morgen noch zugänglich sein wird? Diese Fragen sind die der Digital Humanities.
In der Tageszeitung Der Standard erschien unlängst ein weiterer Beitrag über Open Access, diesmal aus österreichischer Sicht und erwartungsgemäß eher allgemein gehalten. Wer sich mit der Debatte etwas auskennt, findet daher sicher wenige neue Einsichten und stattdessen mehr Erinnerungen an heißere Phasen der Debatte, denn sogar sowohl Roland Reuß mit seiner Warnung vor dem Zwang zu Open Access wie auch Uwe Jochum mit seiner These, dass digitale Daten nur mit unkalkulierbaren, in jedem Fall äußerst hohen Kosten langzeiterhalten werden können, finden sich in dem Artikel wieder.
Aus Sicht von Fu-PusH sind zwei andere Aspekte notierenswert. So bestätigt Bernhard Haslhofer unsere Erfahrung, dass es beim Open Access keine alle Fachkulturen integrierende Generallösung geben kann und auch überhaupt Formen digital vermittelteter Wissenschaftskommunikation in der einen Disziplin der Normal- und in einer anderen ein Sonderfall sind:
Eine Anmerkung von Ben Kaden (@bkaden)
Im Deutschlandfunk konnte man unlängst einen Dialog hören, der alle, die sich permanent im Bereich digitaler Wissenschaftskommunikation und z.B. auch den Digital Humanities bewegen, noch einmal daran erinnern könnte, dass zwischen dem, was für sie selbstverständlich scheint und dem, was wissenschaftsgesellschaftlicher Mainstream ist, eine deutliche Lücke besteht. Benedikt Schulz unterhielt sich mit dem Wissenschaftssoziologen Peter Weingart über Open Access und führte zum Ende des knappen Interviews noch einmal eine Grundfrage an:
„Vielleicht mal mit Blick in die Zukunft: Wird denn digitale Publikation das wissenschaftliche Arbeiten an sich verändern?“
Für uns ist das ja eher ein Blick in die jüngere Vergangenheit, denn die Veränderung ist längst da und an vielen Stellen führte sie zu neuen Quasi-Standards. Peter Weingart betont dies ja auch in seiner Antwort:
Vorhin argumentierte ich bezüglich Wissenschaftskommunikation und Twitter, dass es vermutlich ziemlich schwer ist, ein Argument in 140 Zeichen zu fassen. In 200 Wörtern soll es aber schon gelingen und zwar wissenschaftskommunikativ voll akzeptabel. Dies ist jedenfalls der Anspruch des Journal of Brief Ideas, das Chris Woolston in der aktuellen Ausgabe von Nature beschreibt. (Chris Woolston: Journal publishes 200-word papers. In: Nature 518,277, DOI: 10.1038/518277f) Das Journal verzichtet bislang auf ein Peer Review, was hier eigentlich wunderbar schnell gehen würde, rüstet die Beiträge jedoch so aus, dass sie in den Wissenschaftsdiskurs integrierbar sind. Nämlich mit einer DOI:
„Each article receives a DOI (digital object identifier), a unique number that allows the paper to be archived and cited.“
Der Verzicht auf Peer Review folgt der Einsicht, dass man 200 Wörter auch gleich selbst hinsichtlich ihrer Qualität bewerten kann. Was allerdings nur funktioniert, wenn sich nicht übermäßig viele Short-Read-Texte zu einer potentiell relevanten Long-Read-Gesamtheit addieren. Die Qualitätssicherung soll über ein Ranking/Rating, also post-publication, erfolgen. Geisteswissenschaftliche Inhalte sucht man bisher vergeblich. Aber es gibt einen durchaus interessanten Beitrag aus der Hochschulforschung: Why research reputation trumps teaching reputation in universities (Sean Leaver, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15414). Generell zeigt dieses Beispiel natürlich vor allem, wie man mit neuen Publikationsformen schwindenden Zeitbudgets zu begegnen versucht.
von Ben Kaden (@bkaden)
Die Bewertung von Twitter als Medium der wissenschaftlichen Kommunikation schwankt, so legen es auch die Fu-PusH-Interviews nah, oft zwischen dem Nutzen als Streu- und Netzwerkmedium und Ablehnung bzw. Unverständnis. Selbst vielen, die Twitter wohlwollend gegenüber stehen, erscheint der Gedanke, mittels Microblogging auch so etwas wie einen argumentativen Austausch durchzuführen, eher befremdlich. Das mag daran liegen, dass in den Geisteswissenschaften ein Argument in 140 Zeichen kaum eine Tradition hat. Und sicher sind komplexe Argumentationsführungen schwer abbildbar. Der Tweet-Stream von @NEINQuarterly zeigt immerhin in einem hohen Elaborationsgrad, wie sich wenigstens in englischer Sprache punktgenau und meist nah am Aphorismus Wahrnehmungen und Alltagskommentare in diesem Zeichenumfang verdichten lassen (ein aktuelles Beispiel).
Dass aber auch ein richtiger Dialog unter Nutzung von Twitter möglich ist, zeigt das unten als Screenshot zitierte Beispiel aus der vergangenen Woche. Ausgangspunkt war ein Artikel in der Tageszeitung The Guardian. In diesem argumentierte der Start-Up-Unternehmer Ijad Madisch (Porträt bei Wired), dass die Zeit des PDF als Publikationsformat in der Wissenschaft endlich vorbei sein sollte. Seine Stimme hat diesbezüglich Gewicht, denn sein Start-Up ist das soziale Netzwerk für Wissenschaftler ResearchGate (Wikipedia). Es liegt auf der Hand, dass ein derart kommerzieller Anbieter die in seinem Netzwerk entstehenden Daten als Basis eines Geschäftsmodells nutzen möchte, das wiederum, so es denn angenommen wird, auf die wissenschaftliche Kommunikation selbst zurückwirkt. Madischs Anliegen ist nun, das Format des PDFs durch ein anderes zu ersetzen:“one that’s open, easy to work with and social.“
Er benennt drei Argumente, die gegen das PDF-Format sprechen: Erstens liest es sich schwierig, weil man zu den Zitationen und dann wieder zur Textstelle zurückscrollen muss. Beheben ließe sich das durch eine einfache Optimierung der Bildschirmdarstellung. Zweitens führt nicht zuletzt die Geschlossenheit des Formats dazu, dass die Kommunikation per PDF ein Ein-Kanal-Geschehen bleibt. Feedback zu der so publizierten Forschung erscheint an einem anderen Ort (in einem anderen PDF) und ist so nicht an das Ursprungsdokument angekoppelt. Und drittens ist es zumindest teilweise dem Format des PDFs geschuldet, wenn wissenschaftliche Publikationen so wenig gelesen werden. Was daran liegt, dass die Einzeldatei ohne Kontextualisierung im Netz steht, wobei hier natürlich eine automatisierbare und maschinenlesbare Kontextualisierung gemeint sein muss. Denn alle möglichen Metadaten vom Titel der Zeitschrift über Keywords bis hin zur Korrespondenzadresse der Autoren erzeugen semantisch schon Kontext. Diesen nachzuvollziehen ist sogar technisch möglich, aber eben etwas aufwendig. So ist Forschungskommunikation im PDF-Format für Madisch potentiell verloren: „The results are lost like a package without an addressee.“
Neu ist das alles nicht. So argumenierten zum Beispiel 2006 Michael Seringhaus und Mark Gerstein in einem Artikel namens The Death of the Scientific Paper (in: The Scientist, Vol. 20, Iss.9, S.25) für die Überwindung des wissenschaftlichen Fachaufsatzes wie wir ihn (auch neun Jahre später und ziemlich unverändert) kennen und notierten:
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
Wer die Rolle der Verlage in den Geisteswissenschaften verstehen möchte, profitiert möglicherweise von einem Blick zurück. Vor ziemlich exakt 60 Jahren erschien in der Zeitschrift The Nation ein kurzer Artikel von Victor Reynolds, damals Chef der Cornell University Press, über die Funktion der Universitätsverlage in den USA, also der University Presses, die zu diesem Zeitpunkt immerhin bereits auf eine 85-jährige Geschichte zurückblicken konnten. Die von der Association of American University Presses herausgegebene und von Reynolds zitierte Rollenbeschreibung umfasst drei Aspekte:
- Sie publizieren Forschungsergebnisse zum Nutzen anderen Wissenschaftler, also der Wissenschaftsgemeinschaft.
- Sie publizieren lesbare und authentische Interpretationen dieser Forschung für eine allgemeine Öffentlichkeit („for the layman“).
- Sie publizieren Bücher, die die regionale Kultur und Geschichte behandeln.
Interessant sind aus Sicht der Wissenschaftskommunikation vor allem die Punkte (1) und (2).Wer die Folien von Peter Bekery von dessen Vortrag auf der Academic Publishing in Europe (APE) aus dem Januar 2015 dagegen hält, entdeckt eine bemerkenswerte Kontinuität. Der Publishing-„Mix“ 2015 umfasst Monographien „by scholars, for scholars“, so genannte Crossover Monographies sowie regionalgeschichtliche Publikationen. Also exakt das, was man auch 1955 im Programm hatte. Dazu kommen Literatur (vorwiegend in Übersetzung), Lyrik, Lehrbücher und Zeitschriften.
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden) zu
Craig A. Lambert (2015) The “Wild West” of Academic Publishing. The troubled present and promising future of scholarly communication. In: Harvard Magazien, January-February 2015
In der aktuellen Ausgabe des Harvard Magazine nimmt sich der langjährige und gerade in den Ruhestand eingetretene Redakteur Craig A. Lambert der Frage nach der Zukunft des wissenschaftlichen Kommunizierens („scholarly communication“) an.
Der Ausgangspunkt ist ein ökonomischer – Lambert bezieht sich auf die im vergangenen Jahr viel diskutierte Arbeit Capital in the Twenty-First Century von Thomas Piketty. Und auch uns wird während der fortlaufenden Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich die geisteswissenschaftliche Fachkommunikation verändert und mehr noch, wie sich diese Veränderung gestalten lässt, zunehmend bewusst, welche immense Rolle die Kategorie der Wirtschaftlichkeit spielt und zwar weniger auf Seiten der publizierenden WissenschaftlerInnen sondern viel mehr auf der Seite der Akteure, die die Rahmenbedingungen dieser Kommunikation koordinieren.
Über diese kommen die Probleme jedoch wieder zu den Wissenschaftlern zurück, wie Lambert am Beispiel der nach wie vor fast unverrückbar gegebenen Kopplung von Karrierechancen und Buchpublikationen in den meisten geisteswissenschaftlichen Disziplinen erläutert:
„The current reduction in library purchases of specialized titles, for example, is squeezing monographs out of the market, and in this way affecting the academic job market. A monograph has typically been a young scholar’s first book, often developed from a doctoral dissertation. Although uncommon in academia prior to the 1920s, monographs served as a staple of tenure reviews in American universities in the second half of the twentieth century, especially in the humanities. Academic presses now publish many fewer of them, and their disappearance creates a dilemma for junior scholars already worried about the scarcity of jobs: if there is no monograph, what evidence do you adduce to support your case for tenure“
Über Twitter verbreitet sich heute eine Übersicht, die sehr anschaulich aktuelle Trends digitaler Wissenschaft an der gesamten Entwicklungslinie eines wissenschaftlichen Forschungs- und Kommunikationsprozesses abbildet. Die Abbildung ist Teil einer Posterpräsentation von Bianca Kramer und Jeroen Bosman, die unlängst auf Figshare publiziert wurde:
Kramer, Bianca; Bosman, Jeroen (2015): 101 Innovations in Scholarly Communication – the Changing Research Workflow. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1286826.
Da das Poster und damit auch die Grafik wunderbarerweise unter einer CC BY SA-Lizenz stehen, können wir sie hier ebenfalls bedenkenlos dokumentieren:

Durch die üblichen Kurzzeitkommunikationskanäle wurde die Ankündigung des Zusammengehens der beiden Wissenschaftsverlagsschwergewichte Macmillan Science and Education und Springer Science+Business Media bereits gestern umfänglich verkündet. Jeron Boesman verbreitete gestern über seinen Twitter-Stream eine Grafik, die sehr schön zeigt, wie das neue Unternehmen, dass dann mehrheitlich von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck kontrolliert wird, den gesamten Produktionsprozess von wissenschaftlichem Publikationen mit entsprechenden Angeboten abdeckt.
Wenig überraschend, aber doch für die aktuellen Entwicklungen im Bereich wissenschaftlicher Publikationen notierenswert, ist eine Erklärung des Mergers:
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
Dass ein großer Teil in digitalen sozialen Netzwerken textuell gefasster Inhalte eher als verschriftlichte Oralität zu bewerten ist, ist kein neue These. Vermutlich handelt es sich genauer um eine Hybridform zwischen dem Mündlichen und dem Geschriebenen. Wohin es sich mehr neigt, ist vielleicht eine Frage der Form, sicher aber eine der Intentionalität. Fraglos trifft zu, was die Bezeichnung „Social Media“ eindeutig macht: Diese Medienformen sind unmittelbarer als formalisierte Publikationsformen auf eine direkte soziale Interaktion, also eine sichtbare Kenntnisnahme und Reaktion, ausgerichtet. Sie mit formaleren Publikationsvarianten gleichzusetzen geht fehl. Schwierig ist jedoch ihre rechtliche Bewertung.
In diesem Zusammenhang tauchte die Frage nach dem Status solcher Kommunikationen im Anschluss an zwei Tweets und als Vorläufer zu einem Blogessay von Xiao Mina (Digital Culture is Like Oral Culture Written Down. In: medium.com, 11.01.2015) im Weblog des Juristen James Grimmelmann wieder auf.
In The Laboratorium (2d ser.) erläutert er: