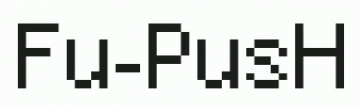In der Tageszeitung Der Standard erschien unlängst ein weiterer Beitrag über Open Access, diesmal aus österreichischer Sicht und erwartungsgemäß eher allgemein gehalten. Wer sich mit der Debatte etwas auskennt, findet daher sicher wenige neue Einsichten und stattdessen mehr Erinnerungen an heißere Phasen der Debatte, denn sogar sowohl Roland Reuß mit seiner Warnung vor dem Zwang zu Open Access wie auch Uwe Jochum mit seiner These, dass digitale Daten nur mit unkalkulierbaren, in jedem Fall äußerst hohen Kosten langzeiterhalten werden können, finden sich in dem Artikel wieder.
Aus Sicht von Fu-PusH sind zwei andere Aspekte notierenswert. So bestätigt Bernhard Haslhofer unsere Erfahrung, dass es beim Open Access keine alle Fachkulturen integrierende Generallösung geben kann und auch überhaupt Formen digital vermittelteter Wissenschaftskommunikation in der einen Disziplin der Normal- und in einer anderen ein Sonderfall sind:
„Wie der Datenwissenschafter berichtet, beschäftigt man sich dort [=bei arXiv.org] nicht nur mit der Archivierung, sondern geht auch der Frage nach, warum der Übergang zur digitalen Publikation in bestimmten Disziplinen weitaus länger dauert als zum Beispiel in der digitalaffinen Informatik. „Das hängt stark ab von der Kultur, die in einer wissenschaftlichen Disziplin herrscht. Daher ist es ganz wichtig, dass man bei Open Access berücksichtigt, dass man einzelne Kulturen nicht sofort verändern kann“, sagt Haslhofer.“
Oder sogar sollte. Erfahrungsgemäß sind neue Formen nur dann durchsetzbar, wenn sie sämtliche Funktionen der Vorgängervarianten zu übernehmen in der Lage sind und zusätzlich Mehrwerte bieten. In vielen Bereichen der Geisteswissenschaften fehlen nach wie vor überzeugende Angebote und mitunter auch Argumente, die unterstreichen, weshalb die wissenschaftliche Kommunikation hauptsächlich digital ablaufen sollte. Zudem lässt sich ein großer Teil der an sich überzeugenden Ansätze – beispielsweise digitale Annotationen – bisher kaum mit den üblichen Bewertungs- und Forschungspraxen der jeweiligen Fachkulturen in Übereinstimmung bringen. Ein drittes Problem, das man hier ergänzen sollte, ist, dass eine stark auf (Pilot)Projekte aufsetzende Transformationsgestaltung angesichts der bekannten Defizite der Projektwissenschaft in puncto Nachhaltigkeit am Ende eher Positionen wie die von Uwe Jochum stützt, als für Forschungs- und Kommunikationsformen zu werben, die das Potential des Digitalen betonen.
Der zweite und vielleicht noch interessantere Aspekt betrifft die Verfügbarkeit von Forschungsdaten:
„Auch dem in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik geratenen Peer-Review-Begutachtungssystem soll mit Open Access Beine gemacht werden, sagt Peter Kraker vom Kompetenzzentrum für wissensbasierte Anwendungen und Systeme (Know Center) an der TU Graz: „Wenn ich heute einen Aufsatz zur Bewertung bekomme, muss ich dem Autor relativ viel glauben, da von zugrunde liegenden Daten oft nicht viel verfügbar ist. Mit einem Open Peer Review hätten wir die Möglichkeit, eher in einen Dialog zu treten.“ Er stützt sich dabei nicht nur auf praktische Erfahrungen, sondern auch auf seine Forschungen zur wissenschaftlichen Publikationskultur im Netz.“
Interessanter ist die Position deshalb, weil sich Peter Kraker erstaunlicherweise nicht etwa für die Entwicklung verbindlicher Standards einer Forschungsdatenpublikationen (zum Beispiel als Open Research Data) ausspricht, sondern die Lösung im offenen Peer Review sieht, was wohl bedeuten soll, dass man einen Autor im Zweifelsfall um eine Präzisierung seiner Ausführungen oder eben die Forschungsdaten zur Einsicht bitten kann. Angesichts des Anspruchs an eine Nachvollziehbarkeit von Forschung ist der Dialog jedoch nur ein Gesichtspunkt. Zweckmäßiger wäre es jedoch, wenn zum Publikationsnarrativ all diejenigen Materialien bereitgestellt werden, die es dem Leser bei Bedarf ohne Rückfrage ermöglichen, die Basis der jeweiligen Forschungsergebnisse direkt ohne viel Aufwand zu konsultieren. So kann man – möglicherweise im Sinne eines Open Peer Review – exaktere Begutachtungen der Güte der hinter einer Erkenntnis stehenden wissenschaftlichen Arbeit von der Datenerhebung über die Methodologie bis zur Datenanalyse vornehmen. Man kann aber zugleich auch abseits von der Fixierung auf den eigentlichen Erkenntnissprung im Gegenstandsbereich sehr viel darüber erfahren, mit welchen Verfahren sich Peers welcher wissenschaftlichen Fragestellung nähern und damit das eigene Forschungsvorgehen reflektieren. Und schließlich ist es auch möglich, bereits erhobene Datensätze für weitere Fragestellungen zu bearbeiten. Um dies wissenschaftlich solide zu können, benötigt man allerdings Einblick in den Gesamtrahmen der Erhebung, was häufig sogar über offene Daten hinausgehen dürfte.
Quelle:
Johannes Lau: Der ewige Streit um den Zugang zum Wissen. In: derStandard.at, 21.08.2015