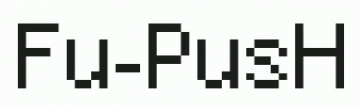Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
I
Dank des Impact-Blogs der London School of Economics erscheint ein Text erneut auf der Bild(schirm)fläche, den Benedikt Fecher vom Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) im August im dortigen Institutsblog publizierte. In diesem erläutert er am Beispiel der Schreibmaschinentastatur, die bis heute auch in ihren Derivaten bis hin zu den Screen-Tastaturen der Smartphones scheinbar unverrückbar der QWERTY- bzw. QWERTZ-Anordnung treu bleibt, was Pfadabhängigkeit („path dependence“) nicht nur für die Technik selbst sondern auch für ihre Folgen bedeutet.
Eine solche Abhängigkeit ist, so Benedikt Fecher, immer dann gegeben, wenn eine in der Vergangenheit unter bestimmten Bedingungen (sich verhakende Typenhebel) getroffene Entscheidung auch dann noch maßgeblich wirkt, wenn diese Bedingungen gar nicht mehr vorliegen und entsprechend zu weniger optimalen Verfahren führt, die dennoch dominieren. Die Fachbezeichnung dafür lautet Lock-in phase.
Eine derartige Eingeschlossenheit sieht der Autor nun auch für das wissenschaftliche Publizieren gegeben. Das Grundverfahren der wissenschaftlichen Kommunikation per Peer Review begutachtetem Fachaufsatz ist dabei seit dem 18. Jahrhundert weitgehend stabil. Die Verarbeitungsdauer vom Manuskript zur eigentlichen Publikation nicht selten ebenso.
II
Es ist müßig, darauf hinzuweisen, dass die Disseminations- und Publikationsmöglichkeiten des Digitalen hier eine Vielzahl anderer Abläufe denkbar machen und de facto wird vieles davon auch probiert. Wenn es jedoch um die eigentlich zählbare Forschung geht, verharrt der wissenschaftliche Mainstream im QWERTY-Standard. Das wissenschaftliche Publikationswesen, wie Benedikt Fecher betont,
„forces itself into a corset that could become too tight in just few years‘ time. Articles today rarely allow interactivity, PDFs are used instead of more usable formats and underlying data is seldom retrievable. The conventional format chosen to present content academia is one for reading, not one for working with.”
Abgesehen davon, dass aus der Perspektive der Diskursbeobachtung dringlichkeitsbasierte Zuspitzungen mit Prognose (could become, too tight, just few years) eher glaubwürdigkeitsmindernd wirken, da sie im Digitaldiskurs oft von Akteuren zur Interessendurchsetzung benutzt werden, die ironischerweise äußerst ahistorisch auf ihren Gegenstand blicken, lässt sich der Aussage aus der Perspektive derer, die die Möglichkeiten von erweiterten Publikationen (enhanced publications) nur zustimmen: Wir befinden in einer Zwischenphase, in der wissenschaftliches Publizieren Modelle der gedruckten Kommunikation digital rekonstruiert ohne allzu umfänglich die Vorteile der binär codierten Netzwerkpublikationen zu nutzen. Erstaunlicher ist zudem, wie groß der Aufwand bisweilen ist, der dieser Simulation von Print im E zugrunde liegt. Dabei ist jedem, der in diesem Feld arbeitet, durchaus bewusst:
„The established system of academic publishing, from submission, review, and publication is in the eye of socio-technological opportunities outdated. It takes too much time, it is too expensive and leads to an artificial scarcity of content. It no longer reflects the zeitgeist.”
Warum hält es sich aber dennoch so erfolgreich?
III
Zeitgeist, so könnte man hier entgegen, sollte nicht das Maß der Wissenschaft sein. Sondern grundsolide Relevanz. Benedikt Fecher trifft insofern das Problem, als er im Kern das betont, was sich aus der Idee der Pfadabhängigkeit ergibt: Die Bedingungen von Wissenschaft und somit auch von wissenschaftlicher Kommunikation haben sich massiv verändert. Es gibt einige schöne Gründe, sich Zugpferde und eine Kutsche zu gönnen. Der tägliche Weg zur Arbeit zählt, abgesehen von der Nische der Amischen, nicht dazu.
Das ist weniger albern als es zunächst klingt, illustriert doch der Wandel der Fortbewegungs- und Transporttechnologien im 20. Jahrhundert sehr deutlich, wie sich sozio-technische Transformationen zwischen den Polen Möglichkeit und Erwartung in Wechselwirkung vollziehen. Eines Tages ist der Tipping Point erreicht und die Innovation wird zum Standard. In der Wissenschaft kann man diesen Kipppunkt als Post-Digital-Scholarship beschreiben. Zwei Aspekte erscheinen dabei bedeutsam: Einerseits, dass derartige Transformationen immer auch viele Nebenwege eröffnen, die aus verschiedenen Gründen scheitern (Magnetschwebbahnen). Und andererseits, dass sie geradewegs wieder in neue Pfadabhängigkeiten führen können.
Was das Beispiel von Kutsche und Automobil aber ebenso zeigt, ist, dass Innovation immer Verbesserung mit Nachahmung koppelt. Wenn Pferdestärken (bzw. horsepower) der Referenzrahmen auch für Greencars bleiben, ist es nicht allzu wahrscheinlich, dass die Druckspuren bei textuellen Digitalkommunikation allzu schnell verschwinden. Und doch wird es sich um strukturell ganz andere Varianten handeln.
Diese Beziehungen und Entwicklungen rückschauend zu verstehen, für die Gegenwart zu differenzieren und perspektivisch bei Trendaussagen zu berücksichtigen, ist die Forschungsagenda einer entsprechend ausgerichteten Technik- bzw. STS-Forschung (Science and Technology Studies). Das FU-PusH-Projekt selbst kann dies strukturgemäß nicht leisten. Wir können aber dennoch entsprechende Impulse sammeln und berücksichtigen.
IV
Entscheidend auch für die Durchsetzung neuer, wenn man so will, Dispositive des wissenschaftlichen Kommunizierens ist freilich immer die Akzeptanz der jeweiligen Varianten. Wäre die Dvorak-Tastatur massiv beworben und danach ebenso massiv nachgefragt worden, könnte sie heute der Standard sein. Auf Innovationsmärkten sind also Investitions-, Verbreitungs- bzw. Durchsetzungskosten für die Anbieter mit den Umstiegskosten der Nutzer und den Einsparungen durch den Umstieg (sowie dem berühmten ROI natürlich) in Beziehung zu setzen.
Beim Beispiel der Tastatur des August Dvorak kamen vor allem zwei Dinge zu einem Hindernis zusammen: Die Anwender sahen den Vorteil nicht so klar wie er, was vielleicht auch daran lag, dass vor allem er selbst die Vorteile der höheren Schreibgeschwindigkeit als Experte präsentierte. Zugleich waren die Umstiegskosten angesichts der Stellung des Maschineschreibens zu dieser Zeit enorm hoch bei vergleichsweise überschaubarem Optimierungsgewinn. (vgl. dazu ausführlich: Stan Liebowitz; Stephen Margolis: The Fable of the Keys. In: Journal of Law and Economics, Vol. 30, No. 1, S. 1-26, April 1990, verfügbar über SSRN: http://ssrn.com/abstract=1069950)
Die Entwicklung digitaler Kommunikationsformen hat den Vorteil, auf etablierte und ziemlich zeitlose Standards (Markup-Strukturen) zurückgreifen zu können, die in etwa das Rad (und nicht das Typenrad) des Digitalen darstellen. Es liegt nahe, alles weitere darauf aufzusetzen, um maximale Beweglichkeit abzusichern. Durch diese Grundstandardisierung ergibt sich die Möglichkeit variabler und modularer Lösungen innerhalb eines Rahmens, die sehr punktuell ausfallen können. Und plötzlich existiert ein Annotator.js, der unser Verständnis von digitaler Kommunikation langfristig weitaus tiefer verändert, als man ursprünglich intendierte. Sogar die Dvorak-Tastatur kann darin einen neuen Anlauf nehmen – man findet sie, neben Emoji-Keyboards und anderer Konkurrenz, im Google-App-Store.
V
Auch im Fall der wissenschaftlichen Kommunikation ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass ein Umbruch erst dann massenwirksam wird, wenn die Nutzer dieser innovativen Kommunikationstechnologien und -verfahren einen spürbaren kommunikationsökonomischen Vorteil haben bzw. diesen erkennen. Erst wenn evident wird, dass die Option beispielsweise von Open Review für diejenigen, die es auf ihre Kommunikation anwenden, zu grundsätzlichen Verbesserungen in der Kommunikationspraxis (oder beim Reputationserwerb) führt, wird sie umfänglich angenommen werden.
Wenn ein System etabliert ist und funktioniert – wie übrigens nach wie vor die QWERTY-Tastatur – dann sind die Umstiegskosten in der Regel sehr hoch. Andere Anreize, wie wir sie beispielsweise bei der Kopplung der Fördermittelzuweisung mit Open Access beobachten, kanalisieren diese in gewisser Weise. Es entstehen aber höhere Verbreitungs- und Durchsetzungskosten und eher eine Folgsamkeits- als eine intrinsische Akzeptanz. Zweitere lässt sich nur entweder durch Einstellung und Einsicht (also Argumentation) oder durch greifbare Vorteile erreichen. Die Kopplung von Fördermitteln und Open Access folgt eher dem Ansatz einer Motivation über die Vermeidung von Nachteilen (nämlich geringeren Ressourcen).
VI
Wir sind hier zugleich ein wenig bei Albert O. Hirschmans Unterscheidung von Voice, Exit, and Loyalty. Auf wahrgenommene Schwächen im System des wissenschaftlichen Publizierens (das hier etwas hemdsärmelig als Organisation interpretiert wird), kann man entweder loyal (=trotz allem) reagieren und wahrscheinlich wurde der Heidelberger Appell aus einem solchen Gedanken mitmotiviert. Loyalität fällt umso leichter, je geringer die Defizite eines Systems einen selbst betreffen und je höher die Kosten bzw. Verluste, die bei einem Umstieg entstehen, scheinen. Man kann auch weiterhin Wissenschaftskommunikation in traditionellen Mustern ablaufen lassen und an vielen Punkten und für viele Akteure funktioniert dies nicht schlecht, an manchen und für manche sogar optimal.
Wir werden uns vermutlich an dynamische Pluralisierungen von Kommunikationspraxen in den Wissenschaften gewöhnen müssen, die sich nicht nur von Disziplin zu Disziplin oder Fachkultur zu Fachkultur unterscheiden, sondern eventuell von Community zu Community. Diese Diversifikation der Kommunikationsbedürfnisse wird für große Bibliothekssysteme (und Wissenschaftsverlage) möglicherweise sogar eine größere Herausforderung als die Digitalisierung selbst.
Die Exit-Strategie nach Hirschmann bedeutet, dass man die Organisation und somit das etablierte wissenschaftliche Publikationssystem verlässt. Das ist ein Wagnis, das anbieterseitig (PLOS One, scienceopen, u.ä.) gegangen wird, für die meisten Wissenschaftler – abgesehen von den rogue scholars – aber derzeit keine Möglichkeit darstellt, weil sie damit auch die Verbindung zur ihrer Community oder Fachgemeinschaft und somit den Status des Wissenschaftlers verlieren würden. Spannend wird hier zu beobachten sein, inwieweit sich Parallel- bzw. Alternativwissenschaften etablieren, die wieder auf die etablierten Forschungs- und Erkenntnisformen zurückwirken. Dass die Grenzen zwischen extra- und intrawissenschaftlich bereits verwischen, macht beispielsweise das Feld der Big-Data-Analysen deutlich. Datenjournalismus und wissenschaftliche Datenvisualisierung liegen methodisch sehr nah bei einander.
Es bleibt die Variante „Voice“, also der Mitgestaltung und Reform mit dem Ziel der Beseitigung wahrgenommener Schwächen. Ihr Vorteil liegt in der Konstruktivität und dem Verfahren des Dialogs. Organisationen, die lange bestehen wollen und nicht genug Mittel oder Möglichkeiten für ein Loyalitätsmanagement besitzen, tun bekanntlich gut daran, solche Verfahren direkt in ihre Struktur einzubetten.
Der Nachteil: Die Voice- bzw. Partizipationsoption schläft dann ein, wenn die Schwächen durch Umstellungen so abgemildert sind, dass sie nicht mehr sonderlich stören. Die Beteiligten bzw. Betroffenen haben in der Regel andere Interessenschwerpunkte, als sich permanent mit der Ausgestaltung und Entwicklung des Rahmens ihrer Interessen zu befassen. Ihnen reicht, wenn er halbwegs stabil bleibt.
Es wird im Innovationsdiskurs zum wissenschaftlichen Publizieren hin und wieder vernachlässigt, dass Wissenschaftler zwar, wenn man so will, permanent in ihrer Forschung zu innovieren versuchen, dafür aber gerade feste Kommunikationsrahmen bevorzugen. Sie möchten zum Beispiel in der Regel verstehen, was Open Access ist und wo für sie dieses Verfahren wie sinnvoll ist. Es liegt aber erfahrungsgemäß nur für wenige in ihrem Interesse, ständig an diesem Diskurs mitzuwirken.
Für Innovationsvermittler, also auch für wissenschaftliche Bibliotheken, kann es dagegen mitunter sehr teuer werden, wenn sie Entwicklungen, Bedarfsverschiebungen und Dialogwünsche nicht beobachten und die ihnen zur Verfügung stehenden Innovationsressourcen (für Entwicklungs-, Verbreitungs- und Durchsetzungskosten) entsprechend gezielt einsetzen.
Wissenschaftsökonomisch lohnen sich derartige Investitionen in der Wissenschaftsinfrastruktur selbstverständlich immer dann, wenn ein Umstieg in jedem Fall erfolgen wird und Umstiegskosten für die Wissenschaftler reduziert werden. Sollte es evident werden, dass zum Beispiel Open Review nicht nur ein Experiment bleibt, sondern als Standard tauglich wird, dann ist dieser Schritt nicht nur sinnvoll sondern sogar zwingend.
VII
Die Herausforderung ist, beides, also das scheinbar Unmögliche, zu tun: in der richtigen Dosis zu bewahren und zu innovieren. Das Beispiel des Fu-PusH-Projektes verdeutlicht, das dafür ein neuer Akteur mit der Aufgabe einer übergeordneten Beobachtung von Entwicklungen sinnvoll ist. Die neutrale Erhebung tatsächlicher Einstellungsmuster, Wünsche, Wahrnehmungen von Schwächen und Stärken etablierter und denkbarer Publikationssysteme bei den Wissenschaftlern hilft, hier exemplarisch im Kontext von „enhanced Publications“, diese äußerst komplexe Gemengelage besser zu verstehen und für Entscheidungen relevantes Wissen zu sammeln. Wird dies auf allgemeine Trends und Möglichkeiten der Gestaltung wissenschaftlicher Publikationen und Kommunikationsinfrastrukturen reflektiert, ergibt sich idealerweise eine belastbare Grundlage in Form eines festen Bezugspunkts für den Diskurs, weitere Forschungen zum Thema und eventuell auch konkretes Gestaltungshandeln.
Im Projekt Fu-Push
„sollen die sich [aus den Potentialen digitaler Möglichkeiten der wissenschaftlichen Kommunikation] ergebenden Konsequenzen für die Serviceausrichtung der akademischen Informationsinfrastruktureinrichtungen analysiert und Empfehlungen zu deren Neuausrichtung erarbeitet werden.“ (Projektbeschreibung auf der Webseite zum Projekt)
Zu diesen Konsequenzen zählt möglicherweise auch, dass sich die QWERTY-Pfade der etablierten Kommunikationsformen noch eine Weile halten, dass Wissenschaftler nicht überall disruptiv sondern Schritt für Schritt punktuell digitale Optionen zur Erweiterung und Verbesserung ihrer Kommunikation und Forschung aufnehmen und vor allem verstehen wollen und müssen, an welchen Stellen welche Umstellung bzw. Innovation tatsächlich sinnvoll ist.
Man kann das natürlich mit Pfadabhängigkeiten erklären und mit der Dvorak-Fabel illustrieren. Man kann darüber klagen, wie weit die Praxis des wissenschaftlichen Publizierens hinter den technischen Möglichkeiten und neuen Konzepten zurück bleibt. Man kann aber auch anerkennen, dass Innovation dann, wenn ein Problem erträglich ist, immer gegenüber dem Bewährten und Funktionierenden in der Bringschuld bleibt, dass sie nicht kontextlos und per se gut sein muss und dass es zugleich fraglos sinnvoll ist, mit den Gestaltungskompetenzen und -szenarien dem Bedarf der Zielgruppe antizipiert drei Schritte voraus sein zu können, auch um die Gesamtentwicklung (=den Bedingungsrahmen der Wissenschaft) mit zu steuern und zu gestalten. Aber man muss nicht unbedingt diese drei Schritte gehen. Wichtiger ist, möglichst genau abschätzen zu können, inwieweit die Richtung stimmt. Das spricht ganz und gar nicht gegen Innovation. Jedoch sehr für eine auf Dialog basierende, auf Bedarfe zugeschnittene und möglichst passgenau vermittelbare.