von Ben Kaden (@bkaden)
Nachdem Hubertus Kohle heute bei seiner Keynote zur Eröffnung der Open-Access-Tage 2015 in Zürich offenbar erneut auf die Bemühungen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hinwies, den öffentlichen Diskurs zu Open Access mit, nun ja, kritischen Noten zu versehen
Die #FAZ als Trutzburg gegen #OpenAccess #oat15
— Joachim Höper (@Joachim_Hoeper) September 7, 2015
haben wir fast ein wenig aus Nostalgie noch einmal im Archiv nachgesehen, was da unter stimmungsprägenden Überschriften wie „Billiger lesen“ (Ausgabe vom 29.04.2015, Nr. 99, S. 13) und „Schmerzen der Wende“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.05.2015, Nr. 104, S. N4) in der jüngeren und älteren Vergangenheit tatsächlich zu Open Access kommuniziert wurde.
Den Rückblick auf die rhetorischen und konzeptionellen Besonderheiten des Heidelberger Appells sparen wir uns und lesen lieber im ersten Beitrag, den wir im FAZ/FAS-Archiv zum Thema ermitteln konnten. In diesem langen Bericht im Wissenschaftsteil der Sonntagszeitung setzte sich Ulf von Rauchhaupt im Oktober 2003 und damit Nachgang mit der Berliner Erklärung solide und differenziert zunächst mit den Gründen selbst für den Trend Richtung OA und dann auch mit den Folgen auseinander.
Zu den Auslösern der Bewegung heißt es:
„Hinter Open Access stehen zwei Motive. Das erste ist das Internet. Erst das Netz der Netze macht es möglich, Datensätze jedem Angeschlossenen jederzeit zugänglich zu machen. Schon in den Anfangsjahren des Internet wurde es vor allem unter Physikern üblich, den Fachkollegen Veröffentlichungen als sogenannte „Preprints“, also vor Abdruck in den Fachzeitschriften, elektronisch zugänglich zu machen. Da lag es nahe, auch die begutachteten und editierten Endprodukte ins Netz zu stellen.“
sowie, Stichwort Zeitschriftenkrise:
„Zudem haben viele Fachverlage in bestimmten Disziplinen quasi ein Monopol und diktieren damit den Preis. Abenteuerliche Steigerungen der Abonnementpreise sind die Folge, was vor allem die öffentlich finanzierten Fachbibliotheken an Universitäten und Forschungsinstitutionen zu immer mehr Abbestellungen zwingt. Die treffen aber erst einmal jene Zeitschriften, die nicht aus den großen Verlagshäusern kommen. Denn die haben die Bibliotheken oft „Bündelabonnements“ vieler Journale aus einem Verlagsprogramm aufgenötigt, von denen sich nicht eben mal der eine oder andere weniger benutzte Titel kündigen läßt. Die Folge ist ein Konzentrationsprozeß: Eine steigende Zahl von Journalen findet sich unter dem Dach immer weniger Verlage, die sich ihre Dienstleistung immer teurer bezahlen lassen können.“
Interessant ist aus der Fu-PusH-Perspektive aber vor allem, wie sich Kulturdaten und damit geisteswissenschaftliche Forschungsdaten als besondere Größe angeführt finden:
„Für die Geistes- und Kulturwissenschaften hat Open Access noch eine umfassendere Bedeutung. Ihnen geht es nicht nur um das Publikationswesen, sondern auch um den ungehinderten Zugang zu ihren Quellen: zu Manuskripten, Artefakten, Gemälde, Fotos, Film- und Tondokumenten – dem ganzen Spektrum des in Museen und Bibliotheken versammelten kulturellen Erbes der Menschheit.
All dies läßt sich ebenfalls digitalisieren und im Internet verfügbar machen. Und wie bei den Forschungsergebnissen geschieht dies heute auch allenthalben – jedoch oft in einer Weise, die den Wissenschaftlern nicht recht sein kann.“
Gemeint ist hier die künstliche Verknappung des Zugangs zu den digitalisierten Fassungen. In den frühen 2000er Jahren befürchtete man vielleicht sogar mehr als aktuell, wo man Zugänge hintergründiger mittels Copyright-Regelungen und Nutzungsbeschränkungen zu steuern versucht, eine Hauruck-Kommerzialisierung des Zugangs. Jürgen Renn vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte sprach von einem Goldrausch und tadelte die Bestrebungen von Bill Gates, mit dem Codex Leicester per CD-Vertrieb noch reicher werden zu wollen. Der Zugang kostet aktuell in der Online-Fassung immer noch 9,90 € und spielt damit in etwa in der Netflix-Liga des gestreamten Filmerbes. Das wirkt heute ein wenig albern und tatsächlich ist es eine Forschungshürde. Ob es daran auch liegt, dass sich im Web of Science keine nennenswerten aktuelleren Aufsätze mit Bezug zum Codex nachweisen lassen und in Bibliothekskategorien jedenfalls per Grobrecherche auch keine Monografien zum Thema, die in den Jahren nach der Digitalisierung entstanden, muss freilich offen bleiben.
In jedem Fall ging es Jürgen Renn ausdrücklich um die Nutzbarkeit von Kulturdaten als digitale Forschungsdaten, als er 2003 eine Digital-Humanities-Perspektive skizzierte.
Das Potential des digitalen Kulturerbes
„liegt gerade in der Vernetzbarkeit von Wissen – und zwar nicht nur von Fachartikeln untereinander, sondern vor allem auch der Artikel mit ihren Quellen. „Ein Fachaufsatz, etwa in der altorientalischen Philologie, lebt von den Fußnoten“, sagt Renn. „Die kann man im Internet nun so gestalten, daß da nicht einfach nur ein Verweis auf den zitierten Keilschriftbrief steht – der im Magazin irgendeines möglicherweise entlegenen Museums liegt. Statt dessen ist da ein Link, und auf Mausklick erscheint eine Zeichnung oder ein digitales Bild der betreffenden Keilschrifttafel.“ […] „Damit ist eine völlig neue Organisation von Wissen möglich“, sagt Renn. „Und es lassen sich damit Fragen bearbeiten, die langfristige Entwicklungszusammenhänge betreffen – und zwar nicht nur anhand von Fallstudien oder kursorischen Essays, sondern auf breiter empirischer Grundlage.““
Das zeigt, dass Open Access und Digital Humanities von Beginn an und zwar vor allem auf der Ebene der Forschungsdaten eng verbunden gesehen wurden und sinnvoller Weise auch heute so gesehen werden. Dass die Entwicklung der Geisteswissenschaften ins Digitale führt, ist für die Autoren der FAZ trotzdem lektüreerfahrungsgemäß nicht immer geboten, wohl aber, gefühlt, immer häufiger. Und auch in diesem Fall spürt man nicht immer das größte Wohlwollen sondern bisweilen eine Betonung dessen, was mit der digitalen Wende verlustig gehen könnte. So eröffnete Niklas Bender vor wenigen Wochen eine Würdigung des Romanisten Hans-Martin Gauger mit den Zeilen:
„Während die Literaturwissenschaft sich schwer damit tut, Teil der Digital Humanities zu werden, ist für die Linguistik die Benutzung von Datenbanken und Rechenprogrammen längst eine Selbstverständlichkeit; auch in ihren konkreten Sprachanalysen ist sie in der Welt von SMS und Internet angekommen.“
Das klingt zunächst ein bisschen naiv (SMS!), aber doch halbwegs zeitgenössisch. Dann aber setzte er dagegen:
„Umso mehr freut es Liebhaber schöner Texte, wenn sich Linguisten für ihren Gegenstand interessieren – zudem in einer Weise, die auch ein größeres Publikum in die Diskussion einbindet: durch Themen wie Sprachbewusstsein, Sprachgefühl oder Stil.“
Wozu dieser Bogen notwendig war, weiß vermutlich nur der Autor allein.
—————
- Ulf von Rauchhaupt: Keine Maut für den Geist. Die Vision vom Internet ohne Kassen. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 19.10.2003, Nr. 42, S.71
- Niklas Bender: Der Sprache bewusst. Der Romanist Hans-Martin Gauger wird achtzig. In: Frankfuter Allgemeine Zeitung, 19.06.2015, Nr. 139, S. 14
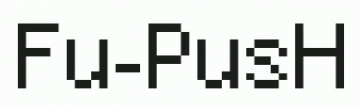


Da wir es gerade auf dem Schreibtisch haben hier die Datenform unseres Tweets zu diesem Blogposting: