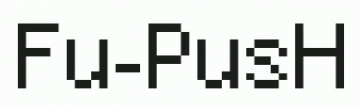Eine Notiz von Ben Kaden @bkaden
Als wir gestern auf das sehr interessante H-Soz-Kult-Diskussionsforum Historische Grundwissenschaften und die digitale Herausforderung stießen, fiel uns nicht allein Torsten Hiltmanns Beitrag zur digitalen Aktualisierung historischer Hilfswissenschaften ins Auge (vgl. hier), sondern auch der noch frischere Text von Gregory Crane zur Quellenkritik im digitalen Zeitalter. Natürlich steckt in diesem Beitrag wie auch in der gesamten Diskussion mehr drin, als der eine Aspekt, auf den ich hier hinweisen möchte. Aber mehr denn je gilt, was im Fu-PusH Statement Finder an verschiedenen Stellen und unter anderem in der Aussage 1809 betont wird:
„Wird zu viel veröffentlicht, dann wird es schnell zu einem Problem nicht unbedingt der technischen Speicher, wohl aber der individuellen Verarbeitungskapazität.“
Das Aufkommen an potentiell relevanten Inhalten zu Themen des Fu-PusH-Interessenspektrums, die ihre Qualität erschwerenderweise oft mittels einer gründlichen argumentativ-interpretativen Analyse entfalten, ist leider enorm und der wissenschaftliche Anspruch an die vollständige Kenntnis der zu einem Thema erschienenen wissenschaftlichen Literatur selbst, von dem man in jeder Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten liest, dann kaum einlösbar, wenn man den Betrachtungsrahmen äußerst eng fasst. Jedenfalls wenn das Thema die digitale Transformation der geisteswissenschaften Kommunikationspraxis ist.
Eine Strategie, damit umzugehen, ist die Entwicklung neuer Formen der Relevanzfilterung (Aussagen zum Thema im Statement Finder), die freilich erst noch (a) brauchbar automatisiert und (b) in Übereinstimmung mit den Erkenntnisbildungsverfahren der Geisteswissenschaften gebracht werden müssen. Was Discovery Systeme angeht haben wir zumindest nur noch selten ein quantitatives Problem. Bei der Relevanz (bzw. dem, was man im Information Retrieval auch Recall und Precision nennt) mag es anders aussehen.
Völlig hilflos scheint man aber, wenn es um Fragen des technologieunterstützten Schlussfolgerns und Verstehens geht. Verfahren des Distant Reading berühren bislang allenfalls die Dimension der Semantik. Die zum Verstehen einer Sprachhandlung und also eines Textes notwendige pragmatische Ebene bleibt nach wie vor weitestgehend wie auch das sinnvolle interpretative Schließen schädelgebundene Kognitionsarbeit. Für das analytische und argumentative Schreiben, also die Diskurs(aus)führung gilt das selbstverständlich gleichfalls. Und so bleibt offen, wie sehr die Entwicklungen, die man unter dem Label der Digital Humanities fasst, tatsächlich epistemologische Wirksamkeit in den Geisteswissenschaften entfalten können. Was zurück zur Debatte um den Stand der Quellenkritik im Digitalen führt.
(Nicht nur) Gregory Crane weist in seinem Beitrag zur Debatte darauf hin, dass die Kompetenz zur kritischen Analysen von Quellen nach wie vor intellektuelle Arbeit und Erfahrung sind, also denkendes Handeln, das als Fertigkeit gelernt werden muss. Die Komplexität dieser Aufgabe führte in der Geschichtswissenschaft zu Spezialisierungen und so genannten Historischen Grundwissenschaften bzw. Historische Hilfswissenschaften wie der Paläographie oder Numismatik. Systematische Grundkenntnisse, die auf die Besonderheiten von Medien- und Materialtypen (Schriften, Münzen, Gravuren, etc.) ausgerichtet waren, ermöglichen, ähnlich der Rolle der Anatomie in biologischen und medizinischen Fächern, eine buchstäblich elementare Kontextualisierung des jeweiligen Betrachtungsmaterials, auf der sich dann die Forschungsfragen aufbauen lässt. Ein Problem in der deutschen Universitätslandschaft scheint nun zu sein, dass die historischen Grundwissenschaften und ihre Vermittlung wahrscheinlich nicht systematisch, aber doch sehr grundsätzlich im Zentrum der Einsparungen an den Hochschulen stehen. Die Folge sind Ausbildungs- und Kompetenzlücken.
„Eine Abwärtsspirale setzt sich in Gang: Nicht nur bei den Studierenden kommt das Wissen nicht mehr an. Durch den Nichtgebrauch leidet auch die Expertise der Lehrenden.“
schreiben Eva Schlotheuber, Claudia Prinz und Rüdiger Hohls in ihrer Einführung in die Debatte bei H-Soz-Kult. Gregory Crane sieht diese Gefahr ebenfalls. Und er sieht in den Digital Humanities keine allumfassende Lösung. Aber, erwartungsgemäß für einen Professor für Digital Humanities, macht er sich für digitale Methoden stark:
„First, digital methods allow us not only to work with more materials than were the case in print but also to represent far more of our interpretations – including dense linguistic and translational such as linguists have used to work with languages that they have not been able to study.“
Eine Schwierigkeit, die bei vielen Digital Scholars und ihren Argumentationen gesehen werden kann, ist freilich die Reduktion des Materialbegriffs. Die Bezeichnung „material“ erweist sich hier als mehrdeutig. Versteht man Material im Sinne des Stofflichen, also beispielsweise des materiellen Trägers, dann gilt: Die Erfahrung des Digitalen und der Arbeit mit Digitalisaten geht nahezu zwangsläufig mit der Vernachlässigung der Materialität einher. Die Konzentration liegt im Digitalen auf den kodifizierbaren Inhalten (= Content), also den Forschungsdaten als „Material“ der Wissenschaft. Das Mengenwachstum durch Digitalisierung ist aus dieser Warte selbstverständlich enorm. Die Materialität wird dagegen auf eine flache, immer nur bildschirmvermittelte Rezeptionsmöglichkeit in Form von Beschreibungen oder Ansichtssimulationen reduziert. 3-D-Drucker könnten hier perspektivisch punktuell faksimilierender wirken, was allerdings die Frage der Materialität nur verschiebt (und nebenbei ein interessantes neues materialkundliches Forschungsfeld eröffnet).
Dem Verlust der direkten Forschung am Objekt tritt der Gewinn einer enormen Reichweite entgegen. Digitale Objekte sind potentiell unbegrenzt reproduzierbar und innerhalb der Darstellungs- und Berarbeitungstechnologie übertragbar und beforschbar. An Stelle des Archivaufenthalts tritt die Bildschirmforschung, was, Stichwort Openness, dazu führt, dass die Exklusivität des Zugangs zum Forschungsobjekt entfällt und sich Phänomene wie Citizen Science weitaus stärker entfalten und vernetzen können, als es in der bereits traditionell starken Kultur der Laienforschung besonders zu heimatgeschichtlichen Themen möglich war. Da niedrigschwellige digitale Publikationswege wie Weblogs als Rückkanal zur Verfügung stehen, wird sich die (nicht nur) geschichtswissenschaftliche Community vermutlich auf eine wachsende Polyphonie im Diskurs einstellen müssen.
Die zweite Hoffnung Gregory Cranes liegt in der maschinengestützten, möglichst weit automatisierten Erkenntnisproduktion:
„Second, the more of our conclusions we can represent in a machine actionable (and thus logically abstracted) form, the more we can disseminate those ideas beyond our native language (e.g., we can potentially increase visibility and use of German-language scholarship).“
Auch hier stehen Reduktionismen als Gefahr im Raum. Sowohl logische als auch sprachliche Abstraktionen, die für Übersetzungen zweifelsohne notwendig sind, entziehen notwendig etwas aus den Geisteswissenschaften, was man, nun ja, „Geist“ nennen könnte, nämlich alle nicht-abstrahierbaren, idiosynkratischen Elemente, die erfahrungsgemäß nicht nur eine Rolle in der Forschung spielen, sondern oft sogar ihren Reiz ausmachen.
Das bedeutet keinesfalls, dass man den aufgezeigten Weg, der typisch für den Transformationsanspruch der Digital Humanities ist, nicht gehen sollte. Es zeigt aber auch, dass man vielleicht in einer Grundwissenschaft der Digitalographie eine intensive Auseinandersetzung mit den Bedingungen und Grenzen dieses Erkenntnisprogramms angehen muss. Es ist für viele Erkenntnisansätze in den historischen Wissenschaften kaum erwartbar, dass digitale Methoden allein ausreichen.
Das weiß natürlich auch Gregory Crane, der als dritten Aspekt eine Art Synthese vorschlägt:
„Third, the vast and explosively growing body of primary materials poses a challenge and an opportunity. The scale of those materials is too great for the use of traditional manual methods alone and automated methods are still imperfect. We need to cultivate a new, distributed, decentralized but still rationally hierarchical culture of scholarly production if we are to analyse billions of words (to speak only of textual sources).“
Die Frage ist freilich, ob der Anspruch, Milliarden von Wörtern wissenschaftlich beforschen zu wollen, in sich sinnvoll ist. Sicher befindet die Wissenschaft der Gegenwart mit dem Übergang ins Digitale auch im Übergang in eine post-kanonische Phase. Und sicher helfen statistische Verfahren und Visualisierungen, Abweichungen und Übereinstimmungen von bestimmten Normalmustern deutlich leichter zu identifizieren. Was man aber am Ende mit dem Anspruch des Verstehens in einem geisteswissenschaftlichen bzw. human-kognitiven Sinn untersucht, dürfte sich auch zukünftig auf einen winzigen Ausschnitt der Geistes- und Kulturproduktion beziehen; unhabhängig davon, ob das jeweilige Interesse dem Typischen oder dem Besondern gilt. Die digitalen Werkzeuge sind daher vor allem Identifikations- und Retrievalmittel, möglicherweise auch Werkzeuge zur Verifikation bzw. Plausibilitätsprüfung (sh. dazu u.a. auch hier), die diesem Schritt vorausgehen und insofern tatsächlich eine Art Hilfswissenschaft.
Gerade wenn wir, wie Gregory Crane fordert, Quellenkritik im Digitalen neu denken müssen, brauchen wir elaboriertere Perspektiven, als sein hier zitierter Dreischritt in der vorliegenden Form eröffnet. Die Komplexität des „analysing of the past“ erhöht sich zusätzlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass bis vor circa 20 Jahren der größte Teil der menschlichen Kulturproduktion, also der analysierbaren Vergangenheit, in nicht digitaler Materialität vorlag, seit einigen Jahren und mit wachsenden Anteilen jedoch rein digital erfolgt. Die Digitale Geschichtswissenschaft bzw. die Digital Humanities könnten sich an dieser Stelle auch und vorrangig auf ihre Rolle einer zukünftigen Wissenschaft konzentrieren, in dem sie die Transformation begleitend heute Analyseverfahren so entwickeln, dass sie direkt in den Produktionsschritt dieser digitalen Kulturspuren eingebunden werden können. Für die anderen Quellenstücke wäre es aber ratsam, die Verfahren, die entwickelt wurden, um der jeweiligen auch materialen Spezifizität der Quellen gerecht zu werden, nicht einfach in der Idee des Forschungsdigitalisats verschwinden zu lassen.
Es gibt abgesehen davon noch einen anderen Aspekt, der an Gregory Cranes Text bemerkenswert ist und daher hier notiert werden soll. Es handelt sich um die Idee der Analog Humanities, die nicht etwa auf analoge Forschungsgegenstände gerichtete Geisteswissenschaften bezeichnen sollen, sondern die, wenn ich es richtig deute, auf die mehr oder weniger bewusst ins Digitale eingeschriebenen Spuren der Printkultur zielt. Man denkt dabei sicher sofort an den so genannten „Goldstandard“ der digitalen Publikationsformate, nämlich das PDF (Aussagen zum Thema im Fu-PusH Statement Finder). Inwieweit sich Bezeichnung und/oder Konzept Analog Humanities (eine weitere Fundstelle) durchsetzen werden oder überhaupt sinnvoll ist, wage ich hier nicht abzuschätzen. Das Label ist in jedem Fall ungewöhnlich und eingängig genug, um es sich für einen möglichen späteren Gebrauch zu notieren.
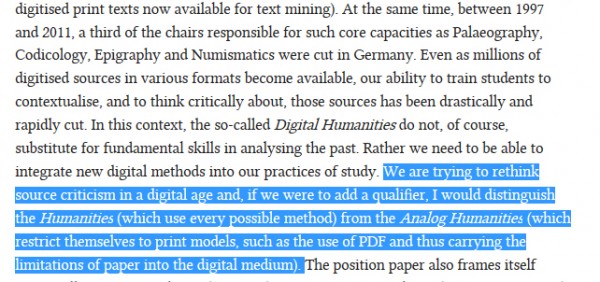
Den gesamten Beitrag Gregory Cranes gibt es hier: Forum: G. Crane: Source Criticism in the Digital Age (H-Soz-Kult, 15.12.2015).
Addendum
Eine weitere Auseinandersetzung mit dem Begriff „Analog Humanities“ liefert Jonathan Sterne in seinem Essay The Example: Some Historical Considerations. Er schreibt:
„[…] I will use the term analog humanities in a matter of fact fashion to refer to humanists‘ uses of analog media technologes – and the analog components of digital technologies – in academic setting and in print, in exactly the same way that digital humanities refers to a complex of technologies and engagements without specifying a particular discipline.“ In: Patrik Svensson; David Theo Goldberg (2015): Between humanities and the digital. Cambridge, Mass: MIT Press, S. 17-34, Zitat S. 18)
Und:
„The analog humanities refers to a nexus of methodological, technological, and institutional conditions across the humanities that have only come in clear focus in retrospect. They refer to the cultural and material infrastructures on which humanists depended and still depend.“ (edb. S.19)