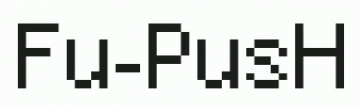Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
Über Twitter verbreitet sich momentan der Call for Papers eines Symposiums des Digital Humanities Incubator (DHI) der School of Culture and Communication, University of Melbourne mit dem Titel „Digital Densities: examining relations between material cultures and digital data“. Der Themenkomplex klingt für die Auseinandersetzung mit den Fragen zukünftiger Publikationsformen in den Geisteswissenschaften augenblicklich hoch interessant. Der Veranstaltungsort ist jedoch eben Melbourne und die damit verbundenen Reisekosten verhindern leider eine teilnehmende Beobachtung. Einen Hinweis darauf wollen wir dennoch hier hinterlassen.
Die Beschreibung zum Call verweist auf einen Aspekt, den die Digitalisierung der Kommunikationsstrukturen und, wenn man so will, die digitale Laboratorisierung bestimmter Teile geisteswissenschaftlicher Forschung fast im Sinne eines neuen Gegenstandsbewusstseins nach sich ziehen. Das Digitale führt in (oder erzwingt sogar) eine Neubewertung des Materialen, schließt einen bereits an sich gegebenen „Material Turn“ an, bei dem die Vielfalt der Relationen zwischen einem Objekt in der Vielfalt seiner Bedeutungs- und Interpretationsgehalte, sozialer Funktionen und eben der materialen Beschaffenheit in den Mittelpunkt rückt. Diese Frage nach dem materiellen Status digitaler Objekte (und damit buchstäblich ihrer Gegenständlichkeit) ist nun auch der Ausgangspunkt des Symposiums:
„The ‘material turn’ in Humanities research has seen a celebration of the physicality of things and a revaluing of the weight of experience, including in the case of digital data.”
Die Bibliothekswissenschaft wäre dabei selbstverständlich ein perfekter Forschungspartner, befasst sie sich doch generell mit der Verbindung (und Aufstellung bzw. Ordnung) von Inhalt und Form von Datenträgern und darüber hinaus mit dem, wenn man so will, sozialen Leben dieser Verbindung. In der digital orientierten Bibliothekswissenschaft verschiebt sich der Aspekt der Materialität folgerichtig auf den der digitalen Technologien sowie der Datenstrukturen. Mehr denn je liegt ihr Potential in der Form von angewandeten Science and Technology Studies (STS). Dafür bedarf es, jedenfalls wenn man sich wissenschaftlich, also mehr oder weniger systematisch und in jedem Fall auf Erkenntnis orientiert, eines theoretischen Rahmens. Der Potsdamer Bibliothekswissenschaftler Hans-Christoph Hobohm erinnert in seiner Einleitung zu Andreas Degkwitz‘ Buch Von Texten zu Daten – Zukunft der Bibliothek (Berlin: Logos Verlag, 2014) an die drei Institutionsformen, welche die französischen Dokumentationsvordenker von Roger T. Pédauque für die Absicherung des Dokumentarischen eines Dokumentes benennen. Sie
„beschreiben, dass für die drei Komponenten der zentralen „Beweisarbeit“ des Dokuments drei Formen von Institutionen notwendig sind bzw. sich in der Gesellschaft immer schon etabliert haben quasi als anthropologische Konstante (wie das Sammeln selbst).“
So gibt es (a) „das Verlagswesen, das Dokumente identifiziert, produziert und den technischen Gegebenheiten optimal angepasst gestaltet sowie Beziehungen herstellt: Wissen überhaupt erkennbar macht.“ Die zweite Aufgabe übernehmen „(Massen-) Medien, die den jeweiligen Dokumenten Aufmerksamkeit widme[n] und Rezeption(szeit) ermöglich[n].“ Und schließlich gibt es noch Einrichtungen des Dokumentierens (also des Sammelns, Erschließens, Archivierens und Verfügbarhaltens), also Bibliotheken, Archive, Museen, deren Rolle, so Pédauque, in der „Dokumentationsarbeit – vorwiegend auf der Seite der Darstellung der Sammlung“ liegt. Sie „ermöglichen […] überhaupt das Lesen und Verstehen der Texte durch Kontextualisierung.“
Hans-Christoph Hobohm vermisst in diesen Überlegungen eine weiterführende Beachtung der Sammlung als öffentliches Gut. Man könnte jedoch auch etwas anderes vermissen und dies ist für die Frage nach dem Publizieren noch maßgeblicher: die Frage der Autorenschaft. Dabei geht es nicht allein darum, zu überlegen, inwieweit das Archiv oder die Bibliothek als Kontextualisatoren die Werkproduktion mit prägen. Sondern auch darum, wie die Immaterialisierungseffekte, die sich bei der Digitalisierung einstellen, die Rollen bei der Erstellung von Dokumenten verschieben. Mehr denn je wird in der Remix-Kultur explizit, wie Dokumente in Beziehung zu anderen Dokumenten entstehen. Die Kombination und Rekombination, das Zitieren, Einbetten, Referenzieren und sonstige Vernetzen ist in digitalen Dokumentenstrukturen nicht nur einfacher möglich. Es wird zum Kern des Dokuments. Autorschaft könnte in einem solchen Zusammenhang mehr und mehr mit einem Schritt der Autorisierung zusammenfallen. Die drei genannten Formen der „Beweisarbeit“ sind zudem vorstellbar in digitalen Publikationszusammenhängen direkt beim Autor und auf einer von ihm kontrollierten Plattform verankerbar. Ein Weblog demonstriert dies in gewisser Weise mikrokosmisch und integriert zudem die Produktion selbst gleich mit.
Wir benötigen daher zumindest als Ergänzung zur Pédauque’schen Funktionalitätsdreiheit tatsächlich einen theoretischen Bezug auf die strukturelle Fassung des digitalen Dokuments, sei es nun materiell oder in Code gegeben, und seine Entstehung bzw. Manipulation sowie darauf, was sich gegenwärtig verändert und was aus dieser Veränderung folgt. Der Call for Papers des DHI-Symposiums verweist diesbezüglich auf Matthew Kirschenbaum und dessen Buch „Mechanisms. New Media and the Forensic Imagination.“ (Cambridge: MIT Press, 2008)
„In his key text Mechanisms, Matthew Kirschenbaum identifies a need to reassess theories of electronic textuality in light of “the material matrix governing writing and inscription in all forms: erasure, variability, repeatability and survivability” (2008, xii).”
Dieses Quartett – die Löschbarkeit, Veränderbarkeit, Wiederholbarkeit und Beständigkeit digitaler Texte (dazu käme eventuell noch eine Ersterstellung) – ist etwas, das das digitale wissenschaftliche Publizieren und seine Ausgestaltung strukturgemäß von der Authentizitätssicherung bis zur digitalen Langzeitarchivierung beschäftigt:
„In the academy, this material turn co-exists with an increasing utilization of digital resources and digital methodologies to preserve and disseminate the findings of our research. These shifts are accompanied by divergent affective responses that include an interest in tactile sensations and a mourning of the loss of the object. There is a new awareness of the forms of lightness or weight attached to the transmission of ideas in and beyond our research communities; the densities of our culture and scholarship. The ever more numerous moments of contact between material culture and digital methodologies open up debates that are of both practical and theoretical significance.”
Aus der Sicht der Materialität ist in diesem Zusammenhang besonders die Ablösung des Inhalts vom Träger von Bedeutung. Daraus ergibt sich eine doppelte Variabilität: der Inhalt ist auf unterschiedlichen selbstverständlich nach wie vor sehr greifbaren Geräten (Displays, Festplatten, Chips, etc. sind materielle Ensembles) abbild- bzw. verarbeitbar. Die Geräte können zugleich diverse Inhalte abbilden bzw. verarbeiten. Die Verbindung zwischen Material und Inhalt manifestiert sich nur zeitweilig und in gewisser Weise bei der Anzeige als Simulacrum. Die Sphäre digitaler Dokumente ist also nicht immateriell jedoch weitgehend ohne zeugnisgebende Verschränkung. Digitale Langzeitarchivierung basiert bislang bekanntlich auf dem Verfahren des regelmäßigen Umkopierens und nicht etwa auf der Konservierung von Hardware. Auch vor diesem Hintergrund ist die Urfrage der Dokumentation, „Was ist ein Dokument?“, mit der Erweiterung „Was wird ein digitales Dokument sein und wie ist seine Beziehung zum Materialen?“ immer neu zu stellen. (mehr dazu u.a. hier: Das Dokument in Bitstromlinienform. Sarah Dudeks Thesen zur Zukunft des Dokuments., LIBREAS-Weblog, 13.11.2012) Und natürlich über das Dokument an sich hinauszutreten und zum Beispiel im Fall der wissenschaftlichen Kommunikation zu fragen, welche Auswirkungen dies auf Kultur, Selbstbild und Praxis von Wissen(schaft)skulturen hat.