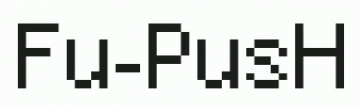Die Januarausgabe von Merkur – Zeitschrift für europäisches Denken ist etwas, was im Fu-PusH-Büro ebenso wie beispielsweise auch noch die #1 der Zeitschrift Grundlagenforschung auf dem To-Read-Stapel liegt. Wir beklagen uns natürlich nicht über das, was man Publikationsflut oder Information Overload nennt, denn wer in einer Disziplin sozialisiert wurde, die permanent über die Unmöglichkeit, das Publizierte möglichst zeitnah in eine einfache und handhabbare Form für die zeitnahe Benutzung als Bibliotheksbestand reflektiert, weiß, dass solche Überschwemmungseffekte keine Neuigkeit darstellen.
Betrüblich ist einzig, dass man viele Diskursbeiträge, die hochrelevant sind und die man eigentlich würdigen möchte, nicht zureichend würdigen kann. Plötzlich ist ein Monat vorüber und die nächsten Neuerscheinungen liegen auf dem Tisch und wollen gesichert, oft auch gelesen und hin und wieder auch wenigstens referiert werden.
Für einen Aufsatz aus dem Jahresauftaktschwerpunkt „Die Gegenwart des Digitalen“ hilft uns glücklicherweise Eric Steinhauer in seinem Weblog Skriptorium aus. Er hat nämlich den für Fu-PusH äußerst einschlägigen Aufsatz Die Gefährdung des geisteswissenschaftlichen Buches. Die USA, Frankreich und Deutschland im Vergleich. von Caspar Hirschi und Carlos Spoerhase nicht nur gelesen sondern referiert ihn auch gleich in etwa so, wie wir es gern längst getan hätten. Dabei kommt er zu folgender Einschätzung:
„Nach der Lektüre des Beitrages bleibt ein gewisses Gefühl der Unzufriedenheit. Denn die Autoren lassen sich zu wenig auf den gerade stattfindenden medialen Wandel ein. Es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass das Format der umfangreichen geisteswissenschaftlichen Monographie den zunehmend auch in den Geisteswissenschaften digital arbeitenden Menschen auf die Dauer gleich wichtig sein wird.“
Dass allerdings die Monographie in vielen geisteswissenschaftlichen Fachgemeinschaften immer noch und absehbar auch zukünftig das Medium sein könnte, mit dem man reüssiert, bestätigen eine Reihe der in Fu-PusH geführten Interviews. „Ausgemacht“ ist das selbstverständlich nicht. Aber so lange Berufungen Monografien als Bewertungsmaßstab heranziehen und die Qualifikationsarbeiten ohnehin fast nur als traditionelle Verlagsmonographien fachgemeinschaftlich als satisfaktionsfähig gelten, bleibt den „digital arbeitenden Menschen“ für die Karriere kaum ein anderer Weg. Wissenschaftskulturell sind die Verschiebungen in den Geisteswissenschaften keinesfalls so umfassend, wie man es manchmal denkt, wenn man sich vor allem auf das Feld der Digital Humanities konzentriert. Da hilft es auch wenig, dass erstaunlich viele GeisteswissenschaftlerInnen Eric Steinhauer vermutlich dort zustimmen würden, wo er schreibt:
„Sehr ernsthaft nachdenken sollte man auch über die Dissertation, die in nicht wenigen Fällen nur eine umständlich verpackte und aufgeblähte These ist. 100 Seiten, originell und gut und elektronisch, können auch reichen. Dafür sollte man lieber bei der Habilitation die große Monographie verbindlich fordern. Hier besteht nämlich im Gegensatz zum Promotionswesen die begründete Hoffnung auf weniger Bücher in höherer Qualität.“
Hundert Seiten, originell und gut aber als Monographie in einer hochangesehenen Reihe des für das Thema einschlägigen Verlags zählen trotzdem mehr, wenn es darum geht, stellensichernde Reputation zu erwerben. Die Herausforderung digitaler Publikationsreihen bleibt der Lückenschluss im Renommee.
Ein weiteres Problem könnte sein, dass die neuen, dynamischeren, offeneren Medienformen für sehr viele WissenschaftlerInnen in vieler Hinsicht kaum einschätzbar sind und auch in ihren Fachkulturen für die wissenschaftssoziologisch relevante Leitkategorie der Reputationszuweisung bisher kaum verortbar sind. Man sollte nicht vernachlässigen, dass sich viele WissenschaftlerInnen vor allem mit ihrem fachwissenschaftlichen Forschungsthema und nicht so sehr mit der Optionsbreite des wissenschaftlichen Publizierens befassen wollen. Und schon gar nicht wollen sie dort experimentieren, wo sie wenig bis keine Wertschätzung für ihre Arbeit erwarten können.
Von Fragen des Urheberrechts über die Zitierbarkeit und Qualitätssicherung bis hin zur Dauerhaftigkeit von E-Publikationen gibt es aktuell viele Aspekte, die momentan für viele eher undurchsichtig wirken. Bis hier keine allgemeine Abschätzbarkeit und Transparenz vorliegen und so lange die traditionellen Kanäle annehmbar funktionieren, dürfte es für digitale Publikationen jenseits des Verlags- und Printparadigma schwer werden, zu einer weithin und übergreifend akzeptierten Form wissenschaftlicher Kommunikation zu werden. Wer die Publikationskultur verändern muss, muss auch die Fachkulturen an vielen Stellen verändern. Und dann reden wir womöglich nicht mehr über die Zukunft des Publizierens in den Geisteswissenschaften. Sondern über die Zukunft der Geisteswissenschaften selbst.